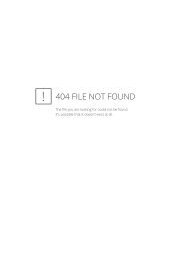zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
216<br />
Sprachmaterial eigens erhoben durch<br />
Fremdinformation, und dies ist heute<br />
noch Standard. Die frühe Dialektgeographie<br />
interessierte vor allem die Lautung<br />
und mußte aber die Lexik einbeziehen<br />
(Gaul/Roß/Pferd), dann führte sie zu den<br />
großen Atlaswerken DSA und DWA. Die<br />
neuere Dialektgeographie hat wieder einen<br />
mehr linguistischen Schwerpunkt,<br />
sie soll, so fordert Löffler, die morphologischen,<br />
syntaktischen und prosodischen<br />
Bereiche »mehr als bisher in die Betrachtung<br />
einbeziehen« (29). Große Projekte,<br />
wie z. B. der Bayerische Sprachatlas, werden<br />
z. T. noch abgeschlossen.<br />
Für angehende Exploratoren und auch<br />
als Meßlatte für die Bewertung von<br />
Korpora ist das relativ kurze dritte Kapitel,<br />
»Spracherhebung« (12 Seiten) aufschlußreich.<br />
Schwachpunkte bei den<br />
Wenker-Sätzen wurden bereits ausgemacht.<br />
Löffler unterschätzt möglicherweise,<br />
wie findig Dialektsprecher mit<br />
Sätzen, wie z. B. Wenker-Satz Nr. 38, auch<br />
in heutiger Zeit umgehen können (45), so<br />
die Erfahrung der Rezensentin. Fragebuch,<br />
-listen, Abbildungen, gezielte Interviews<br />
sind die Standardmethoden der<br />
Erhebung, das freie Gespräch ist wohl<br />
von der Zeit und der benötigten Materialfülle<br />
her das aufwendigste Verfahren.<br />
Im vierten Kapitel erhält man einen<br />
guten Überblick über die Beschreibung<br />
und Darstellung von Mundarten, gemessen<br />
an einer Systematik der Darstellung<br />
von Sprache überhaupt. Dabei ist zu<br />
berücksichtigen, daß »die Geschichte der<br />
Mundartforschung und deren Analyseund<br />
Darstellungsprozeduren« alles andere<br />
als systematisch waren (53). Zu den<br />
am häufigsten gebrauchten Darstellungsformen<br />
gehören die Ortsgrammatiken<br />
und Gebietsmonographien, das Wörterbuch<br />
und die Sprachkarte bzw. -atlanten.<br />
Die Dialektometrie stellt mit Computerhilfe<br />
Daten aus den gängigen Sprachatlanten<br />
auf neue Art dar.<br />
51 Seiten umfaßt das Hauptkapitel des<br />
Buches, »Grammatische Beschreibung<br />
von Mundart«, in dem Phonetik/Phonologie,<br />
Prosodik, Morphologie, Lexik und<br />
Semantik sowie Syntax behandelt werden.<br />
Die jeweilige Ausführlichkeit richtet<br />
sich nach dem Gewicht, das die bisherige<br />
Forschung dem Teilaspekt gegeben hat.<br />
Als Beispiel für den systematischen Aufbau<br />
der Kapitel soll der Teil 5.1 »Phonetik/Phonologie«<br />
dienen: Zuerst wird die<br />
geschichtliche Entwicklung kurz dargestellt,<br />
also Abstammungs- und Bezugsgrammatik<br />
(5.1.1), wobei die Dialektlaute<br />
zu den mhd. Vokalen oder vorahd. Konsonanten<br />
in Beziehung gesetzt werden.<br />
Das historische Bezugssystem, trotz der<br />
Schwäche der monogenetischen Theorie,<br />
bietet eine »größtmögliche Vergleichbarkeit<br />
der Dialekte« und erleichtert einen<br />
Überblick über die vermuteten lautlichen<br />
Entwicklungen. Auf die lauthistorische<br />
Methode folgen nach 1950 »die ersten<br />
Dialektarbeiten auf phonologischer<br />
Grundlage« (69). Deren Ziel ist die Aufstellung<br />
und Beschreibung des Phonemsystems<br />
(inkl. Allophone) einer Sprache<br />
unter Berücksichtigung der Frequenz<br />
von Phonemen und Allophonen. Verschiedene<br />
Darstellungsformen werden<br />
gezeigt und auf ihre Komplexität bzw.<br />
Brauchbarkeit überprüft. Diese stehen<br />
auch in (5.1.3) »Akustische Phonetik/<br />
Phonologie« und (5.1.4) »Generative<br />
Phonologie« <strong>zur</strong> Diskussion. Löffler zieht<br />
den Schluß, daß artikulatorische Phonetik<br />
<strong>zur</strong> Dialektbeschreibung genügt und<br />
die generative Methode eher abschreckt,<br />
zumal sie »nicht mehr einbringt als die<br />
konventionelle« (77). Mit den Teilen<br />
»Lautgeographie oder diatopische Phonologie«<br />
(5.1.5), »Lautgeschichte oder<br />
diachrone Phonologie« (5.1.6) und »Soziophonetik<br />
oder diastratische Phonologie«<br />
(5.1.7) schließt das Teilkapitel Phonetik.