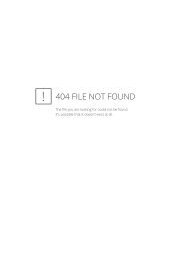zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
der einzelnen Filme; diese spiegeln ihre<br />
Zeit ebenso wider, wie sie Gegenmodelle<br />
<strong>zur</strong> jeweiligen Realität in Vergangenheit<br />
und Zukunft entwerfen, und sind somit<br />
Teil der allgemeinen Geschichte. Deshalb<br />
finden wir hier »Längsschnitte« (12), die<br />
vorrangig den nationalen Zäsuren folgen:<br />
von Kaiserreich und Weimarer Republik<br />
über Nationalsozialismus und<br />
Exil zu zweistaatlicher Nachkriegszeit<br />
und einstaatlicher Gegenwart. Dadurch<br />
treten allerdings gerade die filmhistorischen<br />
Zäsuren zu wenig hervor: nur<br />
un<strong>zur</strong>eichend ersichtlich werden die<br />
über Monarchie und Faschismus hinaus<br />
wirksamen Kontinuitäten im Film, was<br />
durch eine schärfere Untergliederung<br />
möglich gewesen wäre, und zu wenig<br />
berücksichtigt werden zudem die filmspezifischen<br />
Veränderungen durch technische<br />
Innovationen wie z. B. die Einführung<br />
des Tonfilms, was jedoch vor allem<br />
die Aufgabe einer komparatistischen<br />
Filmgeschichte wäre. Erfreulich ist aber<br />
auf jeden Fall der (leider zu kurze)<br />
Beitrag über den Exilfilm, der zu Recht<br />
als Teil der nationalen Filmgeschichte<br />
betrachtet wird – nicht nur, weil hiermit<br />
der Blick auch auf ein anderes Deutschland<br />
zu Zeiten des Dritten Reiches gelenkt<br />
wird, sondern auch, weil emigrierte<br />
deutschsprachige Filmschaffende gerade<br />
im Exil internationale Filmgeschichte<br />
(mit)geschrieben haben.<br />
Historisch angelegt sind auch die sog.<br />
»Querschnitte« (12) über Dokumentarund<br />
Experimentfilm, »Filmkritik und<br />
Filmtheorie«, »Filmzensur und Selbstkontrolle«<br />
sowie »Fernsehen und Film« (während<br />
der »feministische Blick« leider nur<br />
auf die frühen Jahre des Kinos beschränkt<br />
bleibt). Hier könnte man fragen, ob es<br />
nicht doch sinnvoller gewesen wäre, auch<br />
diese Aspekte in den Längsschnitten mitzubehandeln;<br />
so wirken diese Beiträge<br />
wie mehr oder weniger beliebige und mit<br />
z. B. filmsoziologischen und filmtechni-<br />
185<br />
schen Artikeln zu ergänzende Nachträge<br />
zu einer einseitig dem Spielfilm gewidmeten<br />
Geschichtsbetrachtung. Diese Spielfilm-Abschnitte,<br />
die zwei Drittel des gesamten<br />
Bandes ausmachen und noch<br />
durch eine vorzügliche Chronik von 1895<br />
bis 2004 ergänzt werden (567–616), sind<br />
qualitativ und quantitativ sicherlich nicht<br />
einheitlich, aber insgesamt doch sehr informativ<br />
und aufschlußreich, zumal mittlerweile<br />
auch kleine Schwächen beseitigt<br />
worden sind (so belegt Anton Kaes in<br />
Langs M nun auch die künstlerische Bedeutung<br />
des Tons, der nach seiner früheren<br />
Behauptung einfach »neu hinzugekommen«<br />
sein sollte).<br />
Hier sei nur ein einziger Beitrag näher betrachtet:<br />
Katja Nicodemus’ neues Kapitel<br />
über den Film der 90er Jahre, der als zeitgenössischer<br />
Kunstausdruck eine besondere<br />
Bedeutung für den DaF-Unterricht<br />
gewinnt, seine mehr oder minder authentische<br />
Aktualität. Die Autorin weist in den<br />
Einzelfilmen nach, was sie generell über<br />
die Filme dieser Zeit sagt: Am Anfang<br />
»hatte die bundesrepublikanische Gesellschaft<br />
mit der neudeutschen Komödie genau<br />
das Kino, das sie verdiente. Es war die<br />
Komödie des Mittelstandes, mit Filmen,<br />
die sich um privatistische Großstadtbeziehungen<br />
drehten«; »in der zweiten Hälfte<br />
des Jahrzehnts […] traten zunehmend Autorenpersönlichkeiten<br />
ins Bewußtsein der<br />
Öffentlichkeit« und »gewannen Preise<br />
und auch internationale Anerkennung.<br />
Ihre Filme öffneten sich der so lange ausgesperrten<br />
Wirklichkeit« (319). Gemeint<br />
sind Filme von Regisseuren wie Becker<br />
und Tykwer, Dresen und Kleinert, Akin<br />
und Karmakar, Petzold und Schmid, Link<br />
und Schanelec; Filme, die man zumindest<br />
in einzelnen Sequenzen sehen und besprechen<br />
sollte, um sich – als Inländer und<br />
Ausländer – eindrucksvoll und facettenreich<br />
mit den Realitäten und Mentalitäten<br />
der deutschen Gegenwart auseinanderzusetzen<br />
(didaktisches Material hierzu fin-