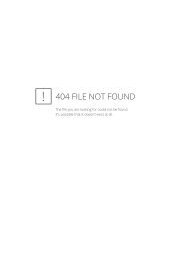zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Sprache, die vor allem berufliche Zielvorstellungen<br />
beinhalten. Aus diesem<br />
Grund entwickelt er ein Konzept für ein<br />
»DaF-Studium mit verstärktem Berufsbezug«<br />
(166). Letztlich stellt Ruth Huber<br />
(Lissabon) Konzepte <strong>zur</strong> Wahrnehmungssensibilisierung<br />
und Theaterarbeit<br />
im Unterricht Deutsch als Fremdsprache<br />
vor.<br />
Die in Teil drei versammelten Beiträge<br />
zu Instrumenten Europäischer Sprachenpolitik<br />
stellen den Gemeinsamen Europäischen<br />
Referenzrahmen (John Trim,<br />
Cambridge), Profile Deutsch mit der ausführlichen<br />
Beschreibung der Lernziele<br />
und Kompetenzstufen für Deutsch als<br />
Fremd-/Zweitsprache (Manuela Glaboniat<br />
u. a.), das Europäische Sprachenportfolio<br />
(Günter Schneider, Freiburg/<br />
Schweiz) und Überlegungen zu einem<br />
»Gesamtsprachenkonzept an Schulen«<br />
(hier für die Schweiz von Georges Lüdi)<br />
vor.<br />
Der letzte Teil faßt unter Analysen die<br />
Befragungsergebnisse von Studierenden<br />
und Sprachlehrern <strong>zur</strong> Sprachlernmotivation<br />
(Ernst Apeltauer, Flensburg), einen<br />
Diskurs <strong>zur</strong> interkulturellen Wirtschaftskommunikation<br />
mit der Forderung<br />
nach einer »Grammatik der Interaktion«<br />
(Bernd Müller-Jacquier, Bayreuth,<br />
320) und eine Untersuchung <strong>zur</strong> »inneren<br />
Mehrsprachigkeit« des Deutschen, die<br />
Markierung der nationalen Varietäten in<br />
drei großen Wörterbüchern (Regula<br />
Schmidlin, Basel) zusammen. Mit diesem<br />
Abschlußaufsatz verdeutlicht der Sammelband<br />
einmal mehr die konsequente<br />
Anwendung des D-A-CH-Konzeptes auf<br />
der Internationalen Deutschlehrertagung.<br />
Fast wünscht man sich mehr Publikationen,<br />
in denen Forschungsergebnisse<br />
von Germanisten aus allen drei deutschsprachigen<br />
Ländern, deren Adressen am<br />
Ende des Bandes erfaßt sind, zusammengeführt<br />
werden.<br />
247<br />
Schnörch, Ulrich:<br />
Der zentrale Wortschatz des Deutschen.<br />
Strategien zu seiner Ermittlung, Analyse<br />
und lexikografischen Aufarbeitung.<br />
Tübingen: Narr, 2002. – ISBN 3-<br />
8233-5156-7. 422 Seiten, € 88,00<br />
(Ulrich Bauer, Mexiko-Stadt / Mexiko)<br />
Endlich ein gehaltvoller Band zu einer<br />
Grundfrage der angewandten Lexikologie:<br />
Was kann eigentlich als der zentrale<br />
Wortschatz des Deutschen gelten und<br />
wie kann man ihn ermitteln?<br />
Dissertationen sind meist mit mehr Gewinn<br />
zu lesen als Sammelbände, wenn<br />
ihnen wirklich geduldige Forschungsarbeit<br />
zugrunde liegt und daraus auch<br />
noch ein Konzept erwächst. Das ist bei<br />
Ulrich Schnörch der Fall. Die Suche nach<br />
dem lexikalischen Zentrum einer Sprache<br />
muß wohl immer damit beginnen, sich<br />
nach tragfähigen Kriterien umzusehen,<br />
mit denen man dieses Zentrum definieren<br />
kann. Daß es sich dabei um arbiträre<br />
Setzungen handelt, die zumindest zu<br />
Beginn auch noch heuristisch sind, läßt<br />
sich nicht umgehen. Schnörch stellt eingangs<br />
klar, daß er weder davon ausgeht,<br />
daß es den Grundwortschatz des Deutschen<br />
gebe, noch daß es die Methode zu<br />
seiner Ermittlung überhaupt geben<br />
könne (7). Das historisch meist verwendete<br />
Kriterium <strong>zur</strong> Festlegung eines<br />
Grundwortschatzes war die Häufigkeit,<br />
und die leichteste Messung der Häufigkeit<br />
ergab sich aus der Auswertung<br />
schriftlicher Korpora: »Grundwortschätze<br />
entstehen als Abfallprodukt der<br />
beginnenden Frequenzforschung.« (12)<br />
Doch so einfach ist es nicht: Nur weil bestimmte<br />
Wörter im Schriftdeutschen besonders<br />
häufig vorkommen, sind sie nicht<br />
unbedingt besonders wichtig oder gar<br />
sprachdidaktisch besonders wertvoll. Ein<br />
bekanntes Beispiel ist die Häufigkeit der<br />
Wochentage: Während Dienstag nur relativ<br />
selten verwendet wird, ist Freitag ein