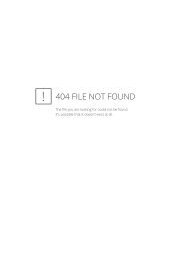zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
234<br />
<strong>zur</strong> Aufgabe der mitgebrachten kulturellen<br />
Identität gedrängt, wie Meng<br />
(43) feststellt. So wird die Herkunftssprache<br />
gerade bei jüngeren Aussiedlern<br />
nicht mehr gefördert, die russische<br />
Sprache fällt häufig als Unterrichtssprache<br />
beim Erlernen der deutschen<br />
Sprache weg (Zimmer, 274). Auch Interferenzen<br />
von russischer Erst- und<br />
deutscher Zweitsprache, wie sie<br />
Bauer/Bäcker skizzieren (95 ff.), und<br />
besondere Sprachschwierigkeiten, die<br />
durch russische Lexeme, eingedeutschte<br />
russische Verben usw. in der<br />
mitgebrachten deutschen Sprache der<br />
Aussiedler verursacht sind, wie sie<br />
Berend feststellt (33 f.), werden beim<br />
gesteuerten Zweitspracherwerb nicht<br />
ausreichend berücksichtigt.<br />
2)Die mitgebrachten Dialekte der deutschen<br />
Sprache spielen beim Erwerb der<br />
Standardsprache eine Rolle, wie die<br />
Untersuchung von Berend in diesem<br />
Band unterstreicht (29).<br />
3)Bisher wurden die sprachlichen und<br />
sozialen Anpassungsprozesse von<br />
Aussiedlern und anderen Migranten<br />
noch nicht in ausreichendem Maße<br />
miteinander verglichen, obwohl das<br />
für die soziolinguistische Migrationsforschung<br />
von erheblichem Interesse<br />
sein könnte. Fennell (194) kommt in<br />
seinem Beitrag zu der interessanten<br />
Feststellung, daß die linguistischen<br />
Merkmale der Lern- und Anpassungsprozesse<br />
beider Gruppen trotz recht<br />
unterschiedlicher Ausgangsbedingungen<br />
fast identisch sind.<br />
4)Mehr im politischen Bereich befindet<br />
sich die Forderung der Teilnehmer der<br />
Tagung, den bereits erwähnten<br />
Sprachtest im Aufnahmeverfahren abzuschaffen.<br />
Einmal fehle dem Test<br />
eine wissenschaftliche Fundierung,<br />
und zum anderen fehle es den Testern<br />
in den deutschen Konsulaten und<br />
Botschaften an Kompetenz (Stölting,<br />
142 ff., 155). »Neben ihrer offiziellen<br />
Funktion der Feststellung von Volkszugehörigkeit<br />
haben die Sprachtests<br />
eine zweite verdeckte Funktion des<br />
Instruments <strong>zur</strong> Regulierung des Aussiedlerstroms<br />
bekommen.« (Reitemeier,<br />
17). Der Test blende das Problem<br />
der Minderheitensituation der<br />
Rußlanddeutschen aus, die historisch<br />
bedingt zu einem Verlust oder zumindest<br />
zu einem eingeschränkten Gebrauch<br />
der deutschen Muttersprache<br />
geführt habe (Reitemeier, 17). Auch<br />
würde die Verknüpfung von Sprache<br />
und ethnischer Zugehörigkeit der realen<br />
Situation in der multiethnischen<br />
(ehemaligen) Sowjetunion widersprechen.<br />
Vielmehr sei die Politik der<br />
deutschen Behörden nach Stölting<br />
(150 ff.) auf die Sprachinhaltsforschung<br />
Leo Weisgerbers <strong>zur</strong>ückzuführen,<br />
die in der Tradition der Sprachideologie<br />
des 19. Jahrhunderts einen<br />
engen Zusammenhang zwischen<br />
Sprache und Weltbild konstruiert.<br />
Methodisch beruhen mehrere Vorträge<br />
auf empirischen Untersuchungen zu<br />
Sprachkompetenz, Sprachverhalten und<br />
-einstellungen von Aussiedlern (Berend,<br />
21 ff.), auf Kurz- und Langzeitbeobachtungen<br />
bei der sprachlichen Integration<br />
von Aussiedlern (Meng, 37 ff.) und in<br />
Interaktionssituationen zwischen Aussiedlern<br />
und Einheimischen (Reitemeier,<br />
59 ff.). Diese drei Beiträge entstanden im<br />
Rahmen eines Projektes des Instituts für<br />
deutsche Sprache <strong>zur</strong> sprachlichen Integration<br />
von Aussiedlern. Neben der<br />
sprachlichen Entwicklung berücksichtigen<br />
sie auch die keinesfalls einheitlichen<br />
Identitätsveränderungen unter den sozialen<br />
Bedingungen und den Wechselwirkungen<br />
von Selbst- und Fremdzuordnung<br />
in Deutschland. So führt zum<br />
Beispiel ein Marginalisierungsdruck<br />
durch die Mehrheitsgesellschaft zu einer<br />
»Überfokussierung des Deutsch-Seins«