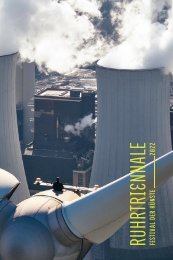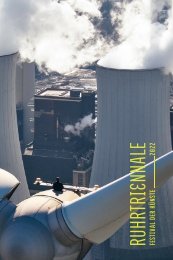Festivalkatalog der Ruhrtriennale 2021-V3
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Wenn ich will, dass Gäste die Stadt, in der ich wohne,
verstehen, steige ich mit ihnen auf den Fernsehturm. Von
dort oben gibt es einen guten Überblick und die Struktur
der Stadt ist schön lesbar. Also stieg ich, als ich das erste
Mal im Ruhrgebiet war, auf einen Förderturm, aber ich verstand
überhaupt nichts. Ich sah nur Hügel (später erfuhr
ich: Halden) und andere Fördertürme (später erfuhr ich:
museale Anlagen). Es war schön, aber bot weder Übersicht
noch Erkenntnis. Also bewegte ich mich fortan durch
einen von mir nicht erkannten Raum. Mit der Straßenbahn,
die merkwürdigerweise nicht Vororte miteinander
verband und dabei durch ein Zentrum fuhr, sondern Zentren
verband und dabei durch Vororte fuhr. Mit dem Auto
das meist stand und wenn es fuhr, flogen die Abfahrtsschilder
der Autobahn mit immer neuen Städte namen im
Sekundentakt an mir vorbei. Oder mit dem ICE, der viel
von Intercity aber wenig von Express hatte. Wollte ich
laufen oder Rad fahren, hieß es immer: Nein, viel zu weit.
Also stand ich oft an Haltestellen: Halte stellen neben verlassenen
Industrieanlagen, Haltestellen an Wald rändern,
Haltestellen zwischen endlosen Schienen, Haltestellen an
Schafsweiden, Tankstellen, Brücken oder direkt auf der
Autobahn. Oft dachte ich: Hier kommt nie was, denn hier
ist das Ende. Aber dann kam immer irgendwann irgendwas
– meistens relativ klein, fuhr los und wenig später
ging die Stadt – oder das, wovon alle sagten, es sei nicht
eine Stadt, sondern das Ruhrgebiet – wieder weiter. Später
fuhr ich dann doch Rad und wunderte mich über den
rasanten Wechsel von Starkstromtrassen und Schrebergärten,
Häfen und Wiesen, Häusern und Arbeitsstätten.
Immer wieder machte ich die eine Erfahrung: Es gibt kein
Ende, es geht weiter. Und immer wieder hatte ich dieses
Gefühl: Ich verstehe den Raum nicht.
Also versuchte ich, eine Karte zu kaufen, die diesen Raum
abbildet. Aber das war gar nicht so einfach: Es gab die
einzelnen Städte, das nördliche und das südliche Ruhrgebiet,
aber keinen richtigen Gesamteindruck. Dann kam
Google Earth und brachte den »Overview«. Ich konnte
endlich das Ruhrgebiet von oben betrachten. Wie merkwürdig
es aussah. So zerklüftet, so unstrukturiert und
doch so gleichmäßig. Auf jeden Fall ganz anders als andere
städtische Regionen. Was für ein urbaner Raum ist
das? Nicht zentral, sondern polyzentristisch, nicht line ar,
sondern komplex, nicht hierarchisch, sondern solidarisch?
Neben vielen Besonderheiten sticht beim ersten
Blick ins Auge: die außergewöhnliche Agglomeration von
Siedlungen, die scheinbar willkürlich durchwachsen sind
von Natur- und Industrieflächen. In einer historischen
Einmaligkeit entwickelte sich das Ruhrgebiet gleichzeitig
mit und durch die Extraktion der Steinkohle und ihre Verarbeitung.
Dies meint nicht nur Industrieareale und ihre
architektonischen Überreste, sondern auch die Aufteilungen
zwischen Wohnanlagen, Natur und Industrie. Was
anderenorts getrennt ist, liegt hier alles zusammen. Alle
Räume sind dem Primat der Montanindustrie nachgeordnet,
durch die einzelnen Nutzungsräume sind Zwischenräume
entstanden, die anschließend in ihrer Bestimmung
definiert wurden.
Dieser Blick von oben ist in den letzten Jahren immer wieder
beschrieben worden, aus der Perspektive der Stadtplanung,
der Soziologie, der Politik. Zentrale Merkmale des
Ruhrgebiets wurden erkannt und diese strukturelle Besonderheit
mit dem Begriff »Ruhrbanität« ausgezeichnet.
Einige Begriffe, wie etwa »Dezentralität«, sind mittlerweile
ins Selbstverständnis der Region und Merkwürdigkeiten
141