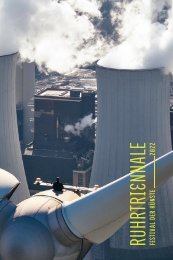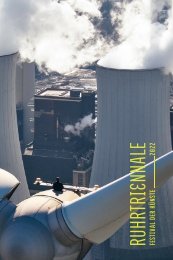Festivalkatalog der Ruhrtriennale 2021-V3
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
schichte ein Ende gefunden. Aber jetzt beginnt die große
Zeit des Mythos. Und daran arbeiten Menschen von unterschiedlichen
Orten aus: Da gibt es Gruppen, die diese
Kumpel-Nummer fahren mit blau-weiß gestreiften Hemden
und »harte Arbeit« beschwören. Es gibt die Szene, die
Lust hat auf urbanes Leben, die sagt: Hier können wir, anders
als in Berlin, Dinge machen, hier gibt’s noch etwas zu
entwickeln. Und natürlich kann man mit Herbert Grönemeyer
»tief im Westen« an der Currywurstbude stehen
und den Mythos dort leben.
BF: Es hat ja auch etwas Heroisches, wenn man über
einen Untergang sprechen kann und dass es nie wieder
so sein wird, wie es war. Man hält es sich damit auch
ein Stück weit vom Leib und mystifiziert es.
Könnte ein Teil der hier spürbaren Melancholie nicht
auch daher rühren, dass der Bergbau gefährlich war
und der Tod in der Grube lauerte? Das muss ja auch
irgendwo »hingegangen« sein.
UCS: Frauen, Mütter, Töchter von Bergleuten unterschiedlicher
Generationen berichteten, dass die Angst immer
präsent war, dass »er nicht mehr nach Hause kommt«.
Doch sie haben sich damit arrangiert und die Oma gut
gepflegt, um möglichst lange von ihrer Bergbau-Rente zu
profitieren, um das mal in ein provokantes Bild zu fassen.
Es könnte schon sein, dass sich aus diesem Spannungsverhältnis
eine Melancholie in die Region eingeschrieben
hat, die noch präsent ist.
BF: Wo sind die Risse und Schneckenspuren in unserer
Zivilisation? Was transportiert der Haarriss, der sich
über die Fassade des Hauses Usher zieht?
Bei Poe muss man abtauchen. Es ist ein In-die-Dunkelheit-Hineingehen
und dabei verlässt man die Welt, in
der man ist, und kommt als Leser:in mit einer anderen
Welt angereichert zurück. Dieser Weltenwechsel ist für
mich auch im Zusammenhang mit dem Bergbau interessant.
Und die Figur, die diesen Wechsel hier für mich vollzieht,
ist der Kumpel, der zum Helden wird, weil er mir irgendwie
das Gefühl gibt, ich wäre selbst hinabgestiegen, als
wäre das ganze Ruhrgebiet in der Grube gewesen. Die,
die wirklich in die Grube gegangen sind, haben eine
Stellvertreterfunktion.
UCS: Immer Zeche und Stahlwerk, doch nicht erst mit den
Universitäten in den 60er-Jahren hat es im Ruhrgebiet
eine Bildungsgesellschaft gegeben, haben sich ganz viele
»Aufstiegsbiografien« entwickelt. Das ist mindestens genauso
wichtig für die heutige Erzählung der Region wie der
Bergbau, der übrigens viel zu dieser Bildungslandschaft
beigetragen hat. Doch die spezielle Folklorisierung und
Romantisierung des Bergbaus läuft auf Hochtouren.
BF: Könnte diese Folklorisierung auch eine Form der
Besänftigung sein? Eine Linderung des Schmerzes
über den Verlust eines »goldenen Zeitalters«, eines
Gefühls der Zusammengehörigkeit? Dieser Schmerz
steckt in allen Künsten: Er ist das Erkennen der eigenen
Einsamkeit.
UCS: Es ist doch eine Perspektive, die Sie zum Glück
in Ihrer Auseinandersetzung mit dem Ruhrgebiet einnehmen
können! Denn alles andere würde ja zu nichts
Neuem führen.
Und ich werde herausgefordert, hinter meine Geschichtswissenschaft
zurückzutreten, um diese literarische Erfahrung
an mich heranzulassen. Auch das Ende vom
Untergang des Hauses Usher eröffnet Assoziationen zur
realen Situation: Da ist der »tiefe dumpfige Teich« und das
»Gebraus von tausend Wassern«, das nicht nur in der
Literatur am Hause Usher tobt, sondern auch real im Ruhrgebiet
bedrohlich wirkt. Wenn das Grubenwasser in der
Bergbaufolgelandschaft nicht permanent weggepumpt
würde, gäbe es bald das Ruhrgebiet nicht mehr. Doch in
der Literatur muss der Untergang kommen …
BF: Er ereignet sich über ein Geräusch – ein »lärmendes
Tosen« – und dann Stille.
»Während ich noch starrte, wurde dieser Riß zusehends
breiter – ein wütender Stoß des Wirbelsturms
fuhr daher – das ganze Rund des Erdtrabanten wurde
plötzlich sichtbar – schwindelnd sah ich die mächtigen
Mauern auseinanderbersten – hörte ein langes lärmendes
Tosen wie das Gebraus von tausend Wassern –
und der tiefe dumpfige Teich zu meinen Füßen schloß
sich langsam und lautlos über den Trümmern des
Hauses Usher.«
Poe, Edgar Allen: Der Untergang des Hauses Usher, in: Sämtliche Erzählungen / Edgar Allen Poe (1. Band), herausgegeben von: Günter Gentsch,
übersetzt von: Barbara Cramer-Nauhaus, Insel-Verlag, Frankfurt/Main 2002, S.297–320.
Fotos: Daniel Sadrowski
148