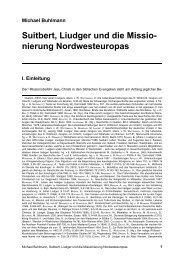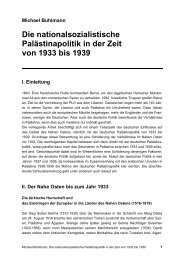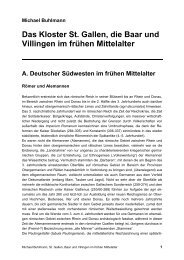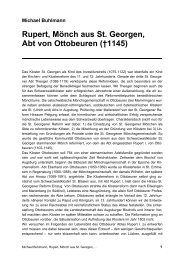Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
geme<strong>in</strong>schaften <strong>in</strong> Hirsau <strong>und</strong> St. Georgen. Die drei <strong>Klöster</strong> entfalteten als benedikt<strong>in</strong>ische<br />
Reformzentren e<strong>in</strong>e über <strong>de</strong>n Schwarzwald h<strong>in</strong>ausgehen<strong>de</strong> Wirksamkeit, auch B<strong>in</strong>dungen an<br />
<strong>de</strong>n Papst <strong>und</strong> <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen König über Privilegierungen gelangen. Im Verlauf <strong>de</strong>s 12.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts verblasste <strong>de</strong>r reformerische Eifer <strong>de</strong>r <strong>Klöster</strong> jedoch, <strong>de</strong>r Benedikt<strong>in</strong>eror<strong>de</strong>n<br />
stand <strong>in</strong> Konkurrenz zu erfolgreicheren Or<strong>de</strong>n wie <strong>de</strong>n Zisterziensern o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Deutschen<br />
Ritteror<strong>de</strong>n. Er<strong>in</strong>nert sei an die Gründung <strong>de</strong>r Zisterze Tennenbach (ca.1160) am Westabhang<br />
<strong>de</strong>s Schwarzwalds o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Prämonstratenserstifts Allerheiligen im Nordschwarzwald<br />
(ca.1190). Das spätere Mittelalter sah darüber h<strong>in</strong>aus z.B. <strong>in</strong> St. Georgen e<strong>in</strong>en Verfall <strong>de</strong>s<br />
monastischen Lebens. Auch Hirsau sank zu e<strong>in</strong>er prov<strong>in</strong>ziellen Mönchsgeme<strong>in</strong>schaft herab<br />
(13. Jahrh<strong>und</strong>ert), während Gengenbach erfolglos darum kämpfte, <strong>in</strong> e<strong>in</strong> adliges Chorherrenstift<br />
umgewan<strong>de</strong>lt zu wer<strong>de</strong>n (15. Jahrh<strong>und</strong>ert). So war <strong>de</strong>r religiöse <strong>und</strong> wirtschaftliche<br />
Zustand <strong>de</strong>r Schwarzwäl<strong>de</strong>r Benedikt<strong>in</strong>erklöster im späten Mittelalter im Allgeme<strong>in</strong>en<br />
schlecht, doch gab es Ausnahmen wie Gengenbach o<strong>de</strong>r St. Blasien, die im 14. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
zum<strong>in</strong><strong>de</strong>st wirtschaftlich konsolidiert erschienen. Dass Reichsabteien <strong>und</strong> Reformklöster <strong>in</strong><br />
<strong>de</strong>n spätmittelalterlichen Sog <strong>de</strong>r sich herausbil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Lan<strong>de</strong>sherrschaften gerieten, ergab<br />
sich aus <strong>de</strong>m Institut <strong>de</strong>r adligen Klostervogtei, die <strong>de</strong>m lan<strong>de</strong>sherrlichen Vogt zunehmen<strong>de</strong>n<br />
E<strong>in</strong>fluss auf Kloster <strong>und</strong> Klosterbesitz verschaffte, <strong>in</strong>sbeson<strong>de</strong>re über das nicht genau abgegrenzte<br />
Obrigkeitsrecht <strong>de</strong>s ius reformandi („Recht zur Klosterreform“).<br />
Spätmittelalterlich ist die von Papst Benedikt XII. (1334-1342) <strong>de</strong>m Benedikt<strong>in</strong>eror<strong>de</strong>n gegebene<br />
Reformbulle Benedict<strong>in</strong>a (1336), die <strong>de</strong>n <strong>Klöster</strong>n e<strong>in</strong>e geordnete Güterverwaltung,<br />
geistige Arbeit <strong>und</strong> <strong>in</strong>nerklösterliche Ausbildung vorschrieb sowie e<strong>in</strong>e Zentralisierung <strong>de</strong>s<br />
Or<strong>de</strong>ns, 36 Or<strong>de</strong>nsprov<strong>in</strong>zen (u.a. die Ma<strong>in</strong>z-Bamberger Prov<strong>in</strong>z für die süd<strong>de</strong>utschen <strong>Klöster</strong>)<br />
<strong>und</strong> Prov<strong>in</strong>zialkapitel verfügte. Geistige <strong>und</strong> wirtschaftliche Erneuerung war auch das Ziel<br />
<strong>de</strong>r benedikt<strong>in</strong>ischen Reformen <strong>de</strong>s 15. Jahrh<strong>und</strong>erts. Schon beim Konstanzer Konzil (1414-<br />
1418) stand <strong>de</strong>r St. Georgener Abt Johannes III. Kern (1392-1427) <strong>in</strong> enger Beziehung zu<br />
<strong>de</strong>n Reformern <strong>de</strong>r Konzilsbewegung, doch entfalteten die vom Donaukloster Melk <strong>und</strong> Weserkloster<br />
Bursfel<strong>de</strong> ausgehen<strong>de</strong>n Reformbewegungen e<strong>in</strong>e ungleich stärkere Wirkung. Ihnen<br />
schlossen sich, teilweise gezwungenermaßen, Hirsau (1458), Alpirsbach (1470 <strong>und</strong><br />
1482) <strong>und</strong> an<strong>de</strong>re <strong>Klöster</strong> an. Dabei erhielten verstärkt Mönche aus <strong>de</strong>m Bürgertum E<strong>in</strong>gang<br />
<strong>in</strong> die Kommunitäten.<br />
Aller reformerischer Eifer wur<strong>de</strong> aber im Verlauf <strong>de</strong>s 16. Jahrh<strong>und</strong>erts <strong>in</strong> Frage gestellt durch<br />
Mart<strong>in</strong> Luther (*1483-†1546) <strong>und</strong> die evangelisch-protestantische Reformation, die <strong>in</strong> Überschneidung<br />
mit lan<strong>de</strong>sherrschaftlichen Interessen zur Aufhebung vieler Benedikt<strong>in</strong>erklöster<br />
führen sollte. Lediglich wenige <strong>Klöster</strong> überlebten wie die Reichsabtei Gengenbach, das<br />
Kloster St. Blasien unter <strong>de</strong>m Schirm <strong>de</strong>r katholischen Habsburger o<strong>de</strong>r St. Georgen, <strong>de</strong>ssen<br />
Mönche im österreichischen Vill<strong>in</strong>gen e<strong>in</strong>e neue Heimat fan<strong>de</strong>n. Doch auch die noch <strong>in</strong> <strong>de</strong>r<br />
frühen Neuzeit bestehen<strong>de</strong>n <strong>Klöster</strong> wur<strong>de</strong>n nach Barock <strong>und</strong> Aufklärung im Zusammenhang<br />
mit <strong>de</strong>r napoleonischen Neuordnung (Mittel-) Europas zwischen 1803 <strong>und</strong> 1806 säkularisiert.<br />
Zisterzienser<br />
Das en<strong>de</strong>n<strong>de</strong> 11. <strong>und</strong> das 12. Jahrh<strong>und</strong>ert s<strong>in</strong>d geprägt durch e<strong>in</strong>e neue Auffassung vom<br />
christlichen Glauben <strong>und</strong> Leben (vita religiosa). Im Verlauf <strong>de</strong>r Jahrzehnte um die Wen<strong>de</strong><br />
vom 11. zum 12. Jahrh<strong>und</strong>ert sollte sich daher e<strong>in</strong>e Differenzierung im Mönchtum anbahnen,<br />
das bisher dom<strong>in</strong>ieren<strong>de</strong> Benedikt<strong>in</strong>ertum (gera<strong>de</strong> cluniazensischer Prägung) wur<strong>de</strong> zu ei-<br />
<strong>Michael</strong> Buhlmann, <strong>Klöster</strong> <strong>und</strong> <strong>Stifte</strong> <strong>in</strong> <strong>Ba<strong>de</strong>n</strong>-<strong>Württemberg</strong> 13