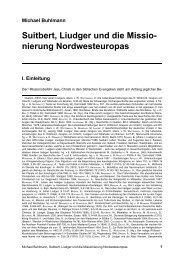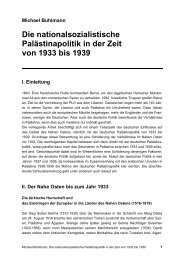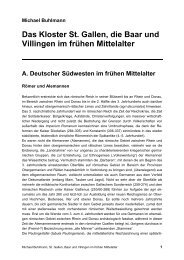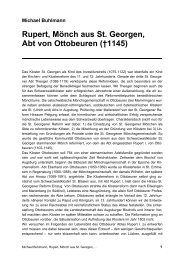Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Heiligenbronn (Franziskaner)<br />
In (Schramberg-) Heiligenbronn bestan<strong>de</strong>n wahrsche<strong>in</strong>lich seit <strong>de</strong>r Mitte <strong>de</strong>s 13. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
e<strong>in</strong> Weiler sowie die Burg Lichtenau. Letztere wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>n Burgherren nach 1353<br />
verlassen – diese sie<strong>de</strong>lten sich im Bernecktal an –, während <strong>de</strong>r Weiler noch bis nach 1444<br />
existierte. Daneben gab es das Lichtenauer Gotteshaus, e<strong>in</strong>e Filiale <strong>de</strong>r Pfarrkirche <strong>in</strong> Dunn<strong>in</strong>gen.<br />
Ausgangspunkt für die weitere kirchliche Entwicklung <strong>in</strong> Heiligenbronn war <strong>in</strong><strong>de</strong>s die<br />
Ansiedlung <strong>de</strong>s Tertiars Konrad, e<strong>in</strong>es Mitglieds <strong>de</strong>s franziskanischen dritten Or<strong>de</strong>ns aus<br />
Vill<strong>in</strong>gen, im Jahr 1385. E<strong>in</strong> Bildstock <strong>de</strong>r Mutter Gottes bzw. e<strong>in</strong> 1442 angefertigtes Gna<strong>de</strong>nbild<br />
Marias wur<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Folgezeit spiritueller Mittelpunkt von Marienverehrung <strong>und</strong><br />
Wallfahrt. E<strong>in</strong>e 1450 errichtete Marienkapelle, <strong>de</strong>r sich bald e<strong>in</strong>e Wallfahrtskirche anschloss,<br />
e<strong>in</strong> Pilgerhaus von 1463/64 <strong>und</strong> die zwischen 1467 <strong>und</strong> 1493 erfolgten Ablässe <strong>de</strong>s Konstanzer<br />
Bischofs för<strong>de</strong>rten zunächst die Wallfahrt nach Heiligenbronn, doch zogen sich die<br />
Vill<strong>in</strong>ger Franziskaner u.a. aus f<strong>in</strong>anziellen Grün<strong>de</strong>n zurück (1532), Heiligenbronn war von<br />
1529 bis 1553/54 Lehen <strong>de</strong>s Ludwig von Rechberg, <strong>de</strong>r Ort wur<strong>de</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>nbergischen<br />
Feh<strong>de</strong> von <strong>de</strong>r Reichsstadt Rottweil zu e<strong>in</strong>em beträchtlichen Teil zerstört (1538).<br />
E<strong>in</strong>e neue Entwicklung nahm Heiligenbronn, als <strong>de</strong>r katholische Priester David Fuchs<br />
(†1885) dort 1857 e<strong>in</strong> Kloster grün<strong>de</strong>te, das als sozial-karitative E<strong>in</strong>richtung noch heute besteht<br />
<strong>und</strong> franziskanische Tertiar<strong>in</strong>nen beherbergt. Seit 1991 gibt es die Stiftung „St. Franziskus<br />
Heiligenbronn“, die neben Heiligenbronn im Bistum Rottenburg-Stuttgart noch 15 weitere<br />
kirchliche E<strong>in</strong>richtungen betreibt.<br />
Heiligkreuztal (Zisterzienser<strong>in</strong>nen)<br />
Vor 1227 war im oberschwäbischen Wasserschapfen e<strong>in</strong>e Schwesternsammlung entstan<strong>de</strong>n,<br />
die vom Salemer Abt Eberhard von Rohrdorf (1191-1240) <strong>de</strong>m Zisterzienseror<strong>de</strong>n e<strong>in</strong>geglie<strong>de</strong>rt<br />
wur<strong>de</strong> (1233). Das Kloster Heiligkreuztal entwickelte sich danach rasch; 1256<br />
wur<strong>de</strong> die Klosterkirche zu Ehren <strong>de</strong>r heiligen Maria <strong>und</strong> <strong>de</strong>s heiligen Kreuzes geweiht, 1319<br />
erfolgte die Weihe <strong>de</strong>r vergrößerten Kirche sowie <strong>de</strong>s Kreuzgangs. Das Nonnenkloster wan<strong>de</strong>lte<br />
sich im späten Mittelalter immer mehr zur Versorgungsanstalt adliger Frauen, erst die<br />
1517 e<strong>in</strong>setzen<strong>de</strong>n Reformen – <strong>in</strong>sbeson<strong>de</strong>re unter <strong>de</strong>r Äbtiss<strong>in</strong> Veronika von Rietheim<br />
(1521-1551) – ermöglichten die Rückkehr zu <strong>de</strong>n zisterziensischen I<strong>de</strong>alen. Von Reformation<br />
<strong>und</strong> Dreißigjährigem Krieg weitgehend unberührt, war Heiligkreuztal seit 1611 vor<strong>de</strong>rösterreichisch,<br />
1803 gelangte die Abtei nach <strong>de</strong>r Säkularisation an <strong>Württemberg</strong>. Trotz <strong>de</strong>s nun<br />
folgen<strong>de</strong>n teilweisen Abrisses von Klostergebäu<strong>de</strong>n blieb vieles erhalten, so die gotische<br />
Kirche mit Nonnenempore <strong>und</strong> <strong>de</strong>r spätgotische Kreuzgang. Seit 1972 ist Heiligkreuztal im<br />
Besitz <strong>de</strong>r Stefanus-Geme<strong>in</strong>schaft, e<strong>in</strong>er 1948 entstan<strong>de</strong>nen Geme<strong>in</strong>schaft von Laien; heute<br />
wird die Klosteranlage als Bildungszentrum genutzt.<br />
Hirsau (Benedikt<strong>in</strong>er)<br />
Um die Mitte <strong>de</strong>s 11. Jahrh<strong>und</strong>erts gewann e<strong>in</strong> Kloster im Nordschwarzwald, im Nagoldtal<br />
große Be<strong>de</strong>utung: Hirsau. Die Anfänge dieser noch zum Fränkischen <strong>und</strong> zur Speyerer Diözese<br />
gehören<strong>de</strong>n Mönchsgeme<strong>in</strong>schaft liegen fast im Dunkel <strong>de</strong>r Geschichte. Irgendwann im<br />
<strong>Michael</strong> Buhlmann, <strong>Klöster</strong> <strong>und</strong> <strong>Stifte</strong> <strong>in</strong> <strong>Ba<strong>de</strong>n</strong>-<strong>Württemberg</strong> 60