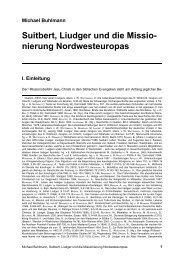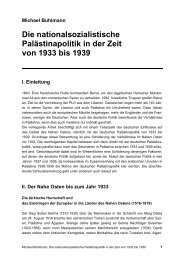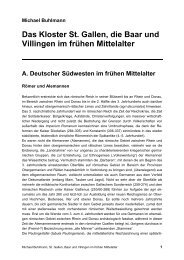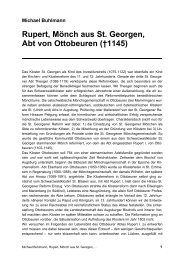Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
„Schwaben“. So begann also mit <strong>de</strong>r Zweiteilung <strong>de</strong>s ottonisch-salischen Herzogtums zwischen<br />
Staufern <strong>und</strong> Zähr<strong>in</strong>gern (1098) die Verengung <strong>de</strong>s politisch-geografischen Begriffs<br />
„Schwaben“ auf <strong>de</strong>n staufischen Machtbereich. Auf <strong>de</strong>r Ebene von staufischem Herzogtum<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>utschem Reich nördlich <strong>de</strong>r Alpen ist nun e<strong>in</strong> Gegen- <strong>und</strong> Mite<strong>in</strong>an<strong>de</strong>r von Herzögen<br />
<strong>und</strong> Königen zu beobachten. Zu verweisen sei noch auf die Kämpfe zwischen Staufern <strong>und</strong><br />
Welfen zur Zeit König Konrads III. <strong>und</strong> auf die nicht immer unproblematischen Beziehungen<br />
Kaiser Friedrichs I. Barbarossa (1152-1190) zu se<strong>in</strong>em Neffen, <strong>de</strong>m Herzog Friedrich IV. von<br />
Rothenburg (1152-1167). Die berühmte Tüb<strong>in</strong>ger Feh<strong>de</strong> (1164-1166) gehört hierher, <strong>in</strong> <strong>de</strong>r<br />
sich <strong>de</strong>r Herzog auf die Seite <strong>de</strong>s Pfalzgrafen Hugo II. von Tüb<strong>in</strong>gen (1152-1182) <strong>und</strong> gegen<br />
Herzog Welf VI. (†1191) <strong>und</strong> <strong>de</strong>ssen Sohn Welf VII. (†1167) stellte. Erst die Vermittlung Kaiser<br />
Friedrichs im März 1166 führte zur Beilegung <strong>de</strong>s Konflikts.<br />
Der vierte Romzug <strong>de</strong>s Kaisers (1166-1168) <strong>und</strong> die Ruhr- o<strong>de</strong>r Malariaepi<strong>de</strong>mie im <strong>de</strong>utschen<br />
Heer brachten durch die große Zahl <strong>de</strong>r Toten auch unter <strong>de</strong>n geistlichen <strong>und</strong> weltlichen<br />
Fürsten, darunter Friedrich von Rothenburg <strong>und</strong> Welf VII., für Schwaben <strong>und</strong> das Herzogtum<br />
e<strong>in</strong>e politische Neuorientierung. Herzog wur<strong>de</strong> nun <strong>de</strong>r Barbarossa-Sohn Friedrich V.<br />
(1167-1191), das Erbe <strong>de</strong>r Grafen von Pfullendorf, Lenzburg u.a., die <strong>in</strong> Rom an <strong>de</strong>r Epi<strong>de</strong>mie<br />
gestorben waren, ermöglichte <strong>de</strong>n Staufern e<strong>in</strong>e erfolgreiche Territorialpolitik im <strong>de</strong>utschen<br />
Südwesten. H<strong>in</strong>zu kam die Anwartschaft auf die schwäbischen Güter <strong>de</strong>r Welfen, die<br />
1190 an die Staufer fielen, h<strong>in</strong>zu kamen Teile <strong>de</strong>s Besitzes <strong>de</strong>r Zähr<strong>in</strong>gerherzöge, die 1218<br />
ausstarben. Schwaben, <strong>de</strong>r staufische Territorialblock <strong>und</strong> das Herzogtum, blieb <strong>in</strong> staufischer<br />
Hand, sieht man von e<strong>in</strong>em kurzen Zwischenspiel am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen Thronstreits<br />
ab, als nach <strong>de</strong>r Ermordung <strong>de</strong>s staufischen Königs Philipp von Schwaben (1198-<br />
1208) <strong>de</strong>r Welfe Otto IV. (1198-1215/18) allgeme<strong>in</strong> <strong>in</strong> Deutschland anerkannt wur<strong>de</strong>. Als sich<br />
schließlich <strong>de</strong>r sizilische Herrscher Friedrich II. von Hohenstaufen (1198/1212-1250) als<br />
<strong>de</strong>utscher König durchsetzte, machte er se<strong>in</strong>en Sohn He<strong>in</strong>rich zuerst zum schwäbischen<br />
Herzog (1217) <strong>und</strong> dann zum König ((VII.), 1220-1235). Beson<strong>de</strong>rs He<strong>in</strong>richs Versuch, e<strong>in</strong><br />
königliches Territorium entlang <strong>de</strong>s Neckars aufzubauen, brachte ihn aber <strong>in</strong> Gegensatz zu<br />
<strong>de</strong>n Fürsten <strong>und</strong> Territorialherren <strong>und</strong> führte zu se<strong>in</strong>er Absetzung (1235), während Kaiser<br />
Friedrich II. mit se<strong>in</strong>er „Übere<strong>in</strong>kunft mit <strong>de</strong>n geistlichen Fürsten“ (1220) <strong>und</strong> <strong>de</strong>m „Statut zu<br />
Gunsten <strong>de</strong>r Fürsten“ (1231) die geistlichen <strong>und</strong> weltlichen Herrschaftsträger <strong>in</strong> Deutschland<br />
privilegierte. Nachfolger He<strong>in</strong>richs <strong>in</strong> Schwaben <strong>und</strong> im Königtum wur<strong>de</strong> Konrad IV. (1235-<br />
1254). Der Kampf zwischen Papsttum <strong>und</strong> Kaisertum, die Bannung <strong>und</strong> Absetzung <strong>de</strong>s Kaisers<br />
auf <strong>de</strong>m Konzil zu Lyon (1245), das Gegenkönigtum He<strong>in</strong>rich Raspes (1246-1247) <strong>und</strong><br />
Wilhelms von Holland (1247-1256) führten dann zum Bürgerkrieg <strong>in</strong> Deutschland, von <strong>de</strong>m<br />
auch Schwaben schwer betroffen war. Er<strong>in</strong>nert sei an Graf Ulrich I. von <strong>Württemberg</strong><br />
(ca.1240-1265), <strong>de</strong>r 1246 auf die Seite <strong>de</strong>r Staufergegner überwechselte. Nach <strong>de</strong>m To<strong>de</strong><br />
Konrads IV. konnte sich <strong>de</strong>ssen Sohn Konrad<strong>in</strong> im schwäbischen Herzogtum behaupten<br />
(1254-1268), bis er bei <strong>de</strong>m Versuch, das sizilische Königreich zu erobern, Karl von Anjou<br />
(1266-1284) unterlag <strong>und</strong> als letzter (legitimer) Staufer auf <strong>de</strong>m Marktplatz von Neapel h<strong>in</strong>gerichtet<br />
wur<strong>de</strong> (1268). Damit war auch das En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s schwäbischen Herzogtums gekommen,<br />
das so lang mit <strong>de</strong>m staufischen Königtum verb<strong>und</strong>en gewesen war.<br />
Im Schwaben <strong>de</strong>r Stauferzeit s<strong>in</strong>d dann folgen<strong>de</strong> gesellschaftliche Entwicklungen auszumachen:<br />
E<strong>in</strong>er starken Bevölkerungszunahme im hohen Mittelalter entsprach e<strong>in</strong> Prozess <strong>de</strong>r<br />
Herrschafts<strong>in</strong>tensivierung bei Lan<strong>de</strong>sausbau, fürstlicher Lan<strong>de</strong>sherrschaft <strong>und</strong> Verherrschaftlichung<br />
<strong>de</strong>r Herzogtümer. Die Besiedlung Südwest<strong>de</strong>utschlands war zu Beg<strong>in</strong>n <strong>de</strong>s 13. Jahr-<br />
<strong>Michael</strong> Buhlmann, <strong>Klöster</strong> <strong>und</strong> <strong>Stifte</strong> <strong>in</strong> <strong>Ba<strong>de</strong>n</strong>-<strong>Württemberg</strong> 7