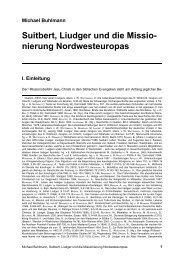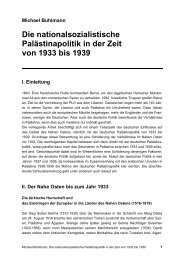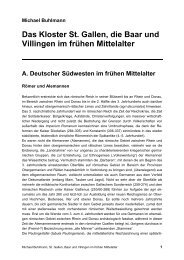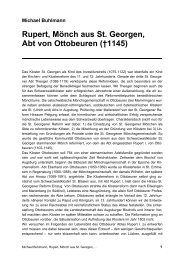Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
gehörten sicher nicht zu <strong>de</strong>n illiterati, son<strong>de</strong>rn sie waren wohl durchaus <strong>de</strong>s Lesens fähig <strong>und</strong><br />
galten damit für die katholische Kirche als Personen, die ihre kirchlichen Ämter, die nur Lesefähigkeit<br />
voraussetzten, ausüben konnten. Wir sehen: Lesen <strong>und</strong> Schreiben gehörten also im<br />
Mittelalter nicht unbed<strong>in</strong>gt zusammen; jemand, <strong>de</strong>r nicht schreiben konnte, konnte sehr wohl<br />
lesen. Dass die Schreibunk<strong>und</strong>igkeit (<strong>in</strong> Late<strong>in</strong>) mitgeteilt wur<strong>de</strong>, kommt allerd<strong>in</strong>gs selten vor.<br />
Insofern ist die vorgestellte Urk<strong>und</strong>e e<strong>in</strong>e Ausnahme, die jedoch nicht dazu führen sollte,<br />
alle<strong>in</strong> daraus e<strong>in</strong>en Verfall St. Georgener Klosterbildung für das beg<strong>in</strong>nen<strong>de</strong> 14. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
zu konstatieren.<br />
Johannes Trithemius. Im Rahmen se<strong>in</strong>er Reformbewegungen <strong>de</strong>s 15. Jahrh<strong>und</strong>erts erlebte<br />
das Benedikt<strong>in</strong>ertum e<strong>in</strong>e gewisse geistige Blüte. Im Kloster Hirsau besann man sich unter<br />
Abt Blasius (1484-1503) auf se<strong>in</strong>e Geschichte („Hirsauer Co<strong>de</strong>x“), man sah e<strong>in</strong>en Nutzen <strong>in</strong><br />
<strong>de</strong>r Geschichtsschreibung, die die rechtliche <strong>und</strong> wirtschaftliche Stabilität e<strong>in</strong>es Klosters mit<br />
verbürgen sollte. Benedikt<strong>in</strong>ermönche fan<strong>de</strong>n auch <strong>de</strong>n Weg <strong>in</strong> die Universitäten, Bibliotheken<br />
wur<strong>de</strong>n vergrößert, Skriptorien <strong>und</strong> Schreibkunst lebten wie<strong>de</strong>r auf.<br />
Beispielhaft stellen wir hier die Person <strong>de</strong>s auch im <strong>de</strong>utschen Südwesten wirken<strong>de</strong>n Johannes<br />
Trithemius (†1516) vor. Johannes aus Trittenheim (bei Trier) ergriff, über 20-jährig, e<strong>in</strong>e<br />
theologische <strong>und</strong> priesterliche Laufbahn <strong>und</strong> trat als Novize <strong>in</strong>s Benedikt<strong>in</strong>erkloster Sponheim<br />
e<strong>in</strong> (1484). Bald nach Ablegung <strong>de</strong>r Profess wur<strong>de</strong> Trithemius Abt <strong>de</strong>s Klosters (1485-<br />
1506), das er zu reformieren versuchte. Gleichzeitig begann se<strong>in</strong>e literarische Tätigkeit als<br />
Verfasser von liturgischen <strong>und</strong> reformerischen Schriften, schließlich als Autor historiografischer<br />
Werke. Während e<strong>in</strong>es Aufenthalts <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> formierte sich Wi<strong>de</strong>rstand <strong>in</strong> Sponheim<br />
gegen Trithemius (1505/06), so dass <strong>de</strong>r Gelehrte auf se<strong>in</strong>e Abtswür<strong>de</strong> verzichtete <strong>und</strong> sich<br />
zu se<strong>in</strong>em Fre<strong>und</strong>, <strong>de</strong>m Würzburger Bischof Lorenz von Bibra (1495-1515), begab. In Würzburg<br />
wur<strong>de</strong> er Leiter <strong>de</strong>s Schottenklosters (1506-1516) <strong>und</strong> setzte se<strong>in</strong>e literarische Tätigkeit<br />
bis zu se<strong>in</strong>em Tod fort.<br />
An Werken <strong>de</strong>s Johannes Trithemius s<strong>in</strong>d aus <strong>de</strong>m Bereich <strong>de</strong>r Geschichtsschreibung überliefert:<br />
e<strong>in</strong>e Schrift über „Die berühmten Männer <strong>de</strong>s Benedikt<strong>in</strong>eror<strong>de</strong>ns“, die bis zum Jahr<br />
1370 reichen<strong>de</strong> „Hirsauer Chronik“ <strong>und</strong> die zwei Teile umfassen<strong>de</strong>n „Hirsauer Annalen“ (bis<br />
1226 bzw. 1514). Dabei ist <strong>de</strong>r geschichtliche Wert se<strong>in</strong>er Schriften durchaus umstritten, s<strong>in</strong>d<br />
ihm doch häufig Fälschungen nachzuweisen. Selbst e<strong>in</strong> angebliches (zweites) Privileg Papst<br />
Urbans II. für das Kloster Hirsau wur<strong>de</strong> Trithemius’ Fälschungstätigkeit zugeschrieben, doch<br />
entpuppt es sich heute als e<strong>in</strong>e Fälschung wahrsche<strong>in</strong>lich aus <strong>de</strong>r Mitte <strong>de</strong>s 12. Jahrh<strong>und</strong>erts.<br />
Gründung <strong>de</strong>r Universität Tüb<strong>in</strong>gen. Den engen Zusammenhang zwischen kirchlichen<br />
Institutionen <strong>und</strong> Bildungse<strong>in</strong>richtungen beleuchtet die Gründung <strong>de</strong>r Tüb<strong>in</strong>ger Universität. In<br />
<strong>de</strong>r geteilten württembergischen Lan<strong>de</strong>sherrschaft konkretisierten sich im Verlauf <strong>de</strong>r<br />
1470er-Jahre Pläne <strong>de</strong>s Uracher Grafen Eberhard im Bart (1450-1496) zur Gründung e<strong>in</strong>er<br />
Universität <strong>in</strong> Tüb<strong>in</strong>gen. Unterstützt von wichtigen Ratgebern, se<strong>in</strong>er Mutter Mechthild von<br />
<strong>de</strong>r Pfalz (†1482) <strong>und</strong> Papst Sixtus IV. (1471-1484), konnte Eberhard 1476 das S<strong>in</strong><strong>de</strong>lf<strong>in</strong>ger<br />
Stift nach Tüb<strong>in</strong>gen verlegen; es diente mit se<strong>in</strong>en Kirchenpfrün<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r zu grün<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Universität<br />
als Ausstattung, die zu<strong>de</strong>m durch das Patronat über die fünf Pfarrkirchen <strong>in</strong> Asch<br />
(Blaubeuren), Brackenheim, En<strong>in</strong>gen, R<strong>in</strong>g<strong>in</strong>gen <strong>und</strong> Stetten ergänzt wur<strong>de</strong>. Die päpstliche<br />
Gründungsbulle vom 11. März 1477 sowie e<strong>in</strong>e gedruckte gräfliche Bekanntmachung vom 3.<br />
<strong>Michael</strong> Buhlmann, <strong>Klöster</strong> <strong>und</strong> <strong>Stifte</strong> <strong>in</strong> <strong>Ba<strong>de</strong>n</strong>-<strong>Württemberg</strong> 29