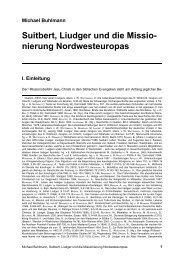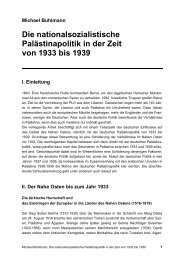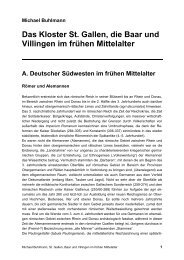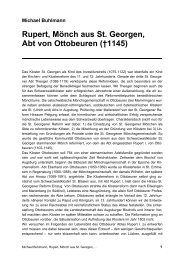Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
8./9. Jahrh<strong>und</strong>ert (v.768?, ca.830?) ist durch Vorfahren <strong>de</strong>r hochmittelalterlichen Grafen von<br />
Calw <strong>in</strong> Hirsau e<strong>in</strong>e Klosterzelle errichtet wor<strong>de</strong>n. E<strong>in</strong> Vorgängerbau <strong>de</strong>r romanischen Aureliuskirche<br />
<strong>de</strong>s 11. Jahrh<strong>und</strong>erts stammt aus dieser Zeit. Das 10. Jahrh<strong>und</strong>ert sah <strong>de</strong>n Verfall<br />
<strong>de</strong>s kle<strong>in</strong>en Klosters, um das Jahr 1000 muss es menschenleer gewesen se<strong>in</strong>. Auf se<strong>in</strong>er<br />
Reise durch Deutschland for<strong>de</strong>rte Papst Leo IX. (Bruno von Egisheim-Dagsburg, 1049-1054)<br />
im Jahr 1049 se<strong>in</strong>en Verwandten, Graf Adalbert II. von Calw (†1099) auf, sich um die Wie<strong>de</strong>rbesiedlung<br />
<strong>de</strong>r Klosterzelle zu kümmern. Doch erst 1065 zogen Mönche <strong>in</strong> Hirsau e<strong>in</strong>.<br />
Der erste Abt Friedrich (1065-1069) erregte <strong>de</strong>n Unwillen se<strong>in</strong>er Mönche <strong>und</strong> <strong>de</strong>s Klosterstifters<br />
Adalbert <strong>und</strong> wur<strong>de</strong> im Jahre 1069 durch e<strong>in</strong>en Mönch <strong>de</strong>s Regensburger Klosters St.<br />
Emmeram ersetzt: Wilhelm von Hirsau (1069-1091).<br />
Unter Wilhelm begann e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>nere <strong>und</strong> äußere Neugestaltung <strong>de</strong>r Abtei im S<strong>in</strong>ne von Gregorianischer<br />
Kirchenreform <strong>und</strong> cluniazensischem Mönchtum. Das „Hirsauer Formular“ vom<br />
Oktober 1075 eröffnete mit <strong>de</strong>m Verzicht <strong>de</strong>s Calwer Grafen Adalbert II. (†1099) auf eigenkirchliche<br />
Ansprüche <strong>und</strong> mit <strong>de</strong>m „Recht <strong>de</strong>r vollen Freiheit“ (ius totius libertatis) bei freier<br />
Abts- <strong>und</strong> Vogtwahl neue Möglichkeiten, die das Kloster im Rahmen <strong>de</strong>r Hirsauer Reformbewegung<br />
umsetzte. Reformierte <strong>Klöster</strong> Hirsauer Prägung, Hirsauer Priorate, Hirsauer<br />
Baustil machten Wilhelm zum „Vater vieler <strong>Klöster</strong>“ <strong>in</strong> Schwaben (u.a. St. Georgen, St. Peter),<br />
Franken, Elsass, Thür<strong>in</strong>gen <strong>und</strong> Kärnten, ohne dass e<strong>in</strong>e auf Hirsau ausgerichtete Kongregation<br />
von <strong>Klöster</strong>n <strong>und</strong> Prioraten zustan<strong>de</strong> kam. Das Hirsauer Kloster sollte im Investiturstreit<br />
(1075-1122) e<strong>in</strong>e be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Rolle spielen, es war <strong>de</strong>r Mittelpunkt <strong>de</strong>r Kirchenreformer<br />
<strong>in</strong> Deutschland.<br />
Unter Wilhelms Nachfolgern verblassten <strong>de</strong>r Ruhm <strong>und</strong> das Innovative <strong>de</strong>s Hirsauer Klosterlebens.<br />
In <strong>de</strong>r Regierungszeit Abt Folmars (1120-1156) wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r e<strong>in</strong>stmals so be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n<br />
Mönchsgeme<strong>in</strong>schaft e<strong>in</strong> Prov<strong>in</strong>zkloster, das unter <strong>de</strong>m wirtschaftlichen Nie<strong>de</strong>rgang,<br />
<strong>de</strong>n Übergriffen <strong>de</strong>r Vögte <strong>und</strong> <strong>de</strong>n Diszipl<strong>in</strong>losigkeiten <strong>de</strong>r Mönche schwer zu lei<strong>de</strong>n hatte.<br />
Insbeson<strong>de</strong>re nahm die reichhaltige Güteraustattung <strong>de</strong>s 11. <strong>und</strong> 12. Jahrh<strong>und</strong>erts – immerh<strong>in</strong><br />
20 Fronhöfe, 1800 Hufen, 37 Mühlen, 14000 Morgen Wald <strong>und</strong> 31 Ortsherrschaften im<br />
nördlichen Schwarzwald, Breisgau, Elsass <strong>und</strong> im Schwäbischen – so ab, dass das Kloster<br />
um 1500 nunmehr nur noch an 100 Orten <strong>de</strong>r näheren Umgebung vertreten war, freilich dort<br />
mit e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>tensiven Besitzstruktur. Die Rentengr<strong>und</strong>herrschaft <strong>de</strong>s 16. Jahrh<strong>und</strong>erts war<br />
dabei geografisch <strong>in</strong> Ämter <strong>und</strong> Pflegen als Verwaltungsbezirke unterteilt, Pflegeorte waren<br />
u.a. Pforzheim <strong>und</strong> Weil <strong>de</strong>r Stadt. Mit <strong>de</strong>m Tod Graf Adalberts VI. (1205-1215) en<strong>de</strong>te die<br />
zuletzt konfliktträchtige Vogtei <strong>de</strong>r Calwer Grafen, die Hirsauer Schirmvogtei kam <strong>in</strong> <strong>de</strong>n Besitz<br />
von Reich <strong>und</strong> staufischem Königtum. Während <strong>de</strong>s Interregnums (1245/56-1273) war<br />
das Kloster daher ohne Vogt, König Rudolf von Habsburg (1273-1291) übertrug die Vogtei<br />
als Reichslehen an die Grafen von Hohenberg, 1334 bezeichnete sich Kaiser Ludwig <strong>de</strong>r<br />
Bayer (1314-1347) als Klostervogt, 1468 war Graf Eberhard V. von <strong>Württemberg</strong> (1450-<br />
1496) Kastvogt <strong>de</strong>r Mönchsgeme<strong>in</strong>schaft, <strong>de</strong>ren Besitz immer mehr <strong>in</strong> <strong>de</strong>n Sog verschie<strong>de</strong>ner<br />
Territorien, allen voran <strong>Ba<strong>de</strong>n</strong> <strong>und</strong> <strong>Württemberg</strong>, geriet.<br />
Das 13. <strong>und</strong> 14. Jahrh<strong>und</strong>ert stellte auch <strong>in</strong> <strong>de</strong>r <strong>in</strong>neren Entwicklung <strong>de</strong>s Klosters e<strong>in</strong>en Tiefpunkt<br />
dar. Abt Eberhard (1216-1227) soll sich schwerer Vergehen schuldig gemacht haben,<br />
unter ihm begann man mit <strong>de</strong>r Veräußerung von Besitz. Die Mönche kamen aus <strong>de</strong>n M<strong>in</strong>isterialenfamilien<br />
<strong>de</strong>r Umgegend, aus <strong>de</strong>m Nie<strong>de</strong>ra<strong>de</strong>l rekrutierten sich die Äbte <strong>und</strong> Prioren.<br />
Mönche mussten vom Abt <strong>in</strong> an<strong>de</strong>re <strong>Klöster</strong> geschickt wer<strong>de</strong>n, da <strong>in</strong> Hirsau ihre Versorgung<br />
nicht sicher gestellt war. Zu Beg<strong>in</strong>n <strong>de</strong>s 15. Jahrh<strong>und</strong>erts, unter Abt Friedrich Iffl<strong>in</strong>ger (1403-<br />
<strong>Michael</strong> Buhlmann, <strong>Klöster</strong> <strong>und</strong> <strong>Stifte</strong> <strong>in</strong> <strong>Ba<strong>de</strong>n</strong>-<strong>Württemberg</strong> 61