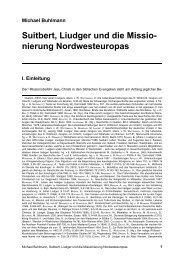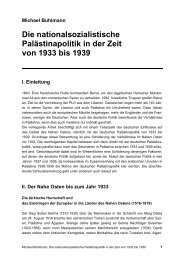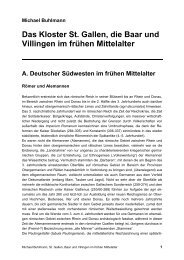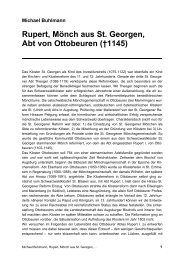Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ter- <strong>und</strong> <strong>Stifte</strong>rvogtei unbestritten, die Ause<strong>in</strong>an<strong>de</strong>rsetzungen nach <strong>de</strong>m Tod <strong>de</strong>s söhnelosen<br />
Herzogs Berthold V. (1186-1218) en<strong>de</strong>ten mit <strong>de</strong>r Übernahme <strong>de</strong>r Vogtei durch Bertholds<br />
Neffen Graf Eg<strong>in</strong>o V. <strong>de</strong>m Jüngeren von Urach <strong>und</strong> Freiburg (†1236/37) (1221/26), <strong>de</strong>r nun<br />
advocatus ac <strong>de</strong>fensor („Vogt <strong>und</strong> Verteidiger“) <strong>de</strong>r Mönchsgeme<strong>in</strong>schaft wur<strong>de</strong>. Die Vogtei<br />
verblieb bei <strong>de</strong>n Freiburger Grafen, die manchmal recht eigenmächtig über klösterliche Güter<br />
<strong>und</strong> Rechte verfügten (1284, 1314). Die Bedrückung durch die Vögte wur<strong>de</strong> so groß, dass<br />
sich das Kloster an Kaiser Karl IV. (1347-1378) wandte <strong>und</strong> – vielleicht im Rückgriff auf eventuell<br />
vorhan<strong>de</strong>n gewesene Beziehungen zu Kaiser Friedrich II. (1212-1250) – <strong>de</strong>n Schirm<br />
<strong>de</strong>s Reiches erlangte (1361). Das Privileg wur<strong>de</strong> 1443 bestätigt, 1498 sprach Kaiser Maximilian<br />
I. (1493-1519) von <strong>de</strong>r Zugehörigkeit <strong>de</strong>s Klosters zum Reich. Unter<strong>de</strong>ssen war die Vogtei<br />
auf <strong>de</strong>m Weg <strong>de</strong>r Verpfändung (ab 1371) endlich an Markgraf Wilhelm von Hachberg-<br />
Sausenberg (1428-1441) gelangt (1441). 1526 übernahmen die Habsburger die Klostervogtei.<br />
Im 11. <strong>und</strong> 12. Jahrh<strong>und</strong>ert erwarb die Mönchsgeme<strong>in</strong>schaft <strong>in</strong> St. Peter – nicht zuletzt durch<br />
die Zuwendungen <strong>de</strong>r <strong>Stifte</strong>rfamilie – be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n Besitz im Nahbereich, im Breisgau, auf<br />
<strong>de</strong>r Baar, bei Weilheim, <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Mittelschweiz. Kloster <strong>und</strong> Klosterort lagen auf <strong>de</strong>m Seelgut<br />
(Salland) im engeren Immunitätsbezirk <strong>de</strong>s Klosters, <strong>in</strong> <strong>de</strong>n Tälern <strong>de</strong>r Umgebung bil<strong>de</strong>te<br />
sich e<strong>in</strong> kompaktes Klostergebiet aus. Im Breisgau gab es Villikationen, fronhofmäßig organisierten<br />
Besitz, im Schwarzwald existierten auf Rodungsland bäuerliche Erblehen (feoda),<br />
wobei durch Teilung <strong>und</strong> Verkauf e<strong>in</strong>e ausgeprägte Besitzzersplitterung auftrat (13./14. Jahrh<strong>und</strong>ert).<br />
Infolge <strong>de</strong>r Bevölkerungsverluste im 14. Jahrh<strong>und</strong>ert kam es zu Wüstungsprozessen<br />
<strong>und</strong> zum Rückgang <strong>de</strong>r gr<strong>und</strong>herrschaftlichen E<strong>in</strong>nahmen. Die D<strong>in</strong>gro<strong>de</strong>l von 1416 <strong>und</strong><br />
1456 benennen die daraus resultieren<strong>de</strong>n Schwierigkeiten zwischen Kloster <strong>und</strong> Vogt. Sie<br />
zeigen zu<strong>de</strong>m die Art <strong>de</strong>r Güter auf: D<strong>in</strong>g- <strong>und</strong> Meierhöfe, eigenbewirtschaftete Güter <strong>de</strong>s<br />
Seelguts, bäuerliche Lehengüter.<br />
1238 <strong>und</strong> 1437 ist das Kloster St. Peter Opfer e<strong>in</strong>er Brandkatastrophe gewor<strong>de</strong>n, 1436 wur<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>m Abt Johannes Tüffer (1427-1439) die Pontifikalien verliehen. Das Kloster verlor im<br />
späten Mittelalter an Be<strong>de</strong>utung, die Klosterreformen <strong>de</strong>s 15. Jahrh<strong>und</strong>erts fan<strong>de</strong>n ke<strong>in</strong>en<br />
E<strong>in</strong>gang, <strong>de</strong>r Besitz blieb aber weitgehend erhalten, auch im Zeitalter <strong>de</strong>r Reformation. Abt<br />
Peter Gremmelsbach (1496-1512) erneuerte Zähr<strong>in</strong>gertradition <strong>und</strong> <strong>Stifte</strong>rmemoria, die Klostergebäu<strong>de</strong><br />
s<strong>in</strong>d im 17. <strong>und</strong> 18. Jahrh<strong>und</strong>ert barock neu erbaut wor<strong>de</strong>n. Die Mönchsgeme<strong>in</strong>schaft<br />
wur<strong>de</strong> 1806 aufgehoben.<br />
St. Peter <strong>in</strong> Wimpfen (Stift)<br />
Im Tal vor <strong>de</strong>r Reichsstadt Wimpfen, auf <strong>de</strong>m Bo<strong>de</strong>n e<strong>in</strong>es Römerkastells bzw. e<strong>in</strong>er römischen<br />
Stadt, wur<strong>de</strong> von Bischof Adalbero von Worms (1065-1070) e<strong>in</strong> Stift gegrün<strong>de</strong>t, das <strong>in</strong><br />
<strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Jahrh<strong>und</strong>erten Sitz e<strong>in</strong>es Archidiakonats im Wormser Bistum war sowie sich<br />
auf Gr<strong>und</strong> bischöflichen <strong>und</strong> königlichen Schutzes gegen die Stadt Wimpfen behaupten<br />
konnte. Im späten Mittelalter lebten hier zwölf Stiftsherren, zwei Pfrün<strong>de</strong>n waren für die Besoldung<br />
von Hei<strong>de</strong>lberger Universitätslehrern bestimmt, die übrigen Präben<strong>de</strong>n g<strong>in</strong>gen an<br />
Adlige (Ritterstift), Vikare übten als Priester die gottesdienstlich-liturgischen Verpflichtungen<br />
aus. Ab 1269 wur<strong>de</strong> die noch heute bestehen<strong>de</strong>, hochgotische Stiftskirche St. Peter errichtet,<br />
<strong>de</strong>r sich e<strong>in</strong> gotischer Kreuzgang anschließt. Bekannt s<strong>in</strong>d die um 1270/80 angefertigten<br />
Glasfenster, die sich <strong>in</strong>s gotische Maßwerk <strong>de</strong>s Gotteshauses e<strong>in</strong>fügen. Das Stift überstand<br />
<strong>Michael</strong> Buhlmann, <strong>Klöster</strong> <strong>und</strong> <strong>Stifte</strong> <strong>in</strong> <strong>Ba<strong>de</strong>n</strong>-<strong>Württemberg</strong> 80