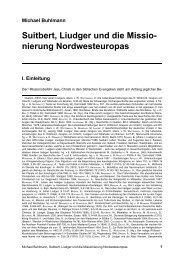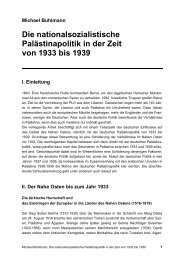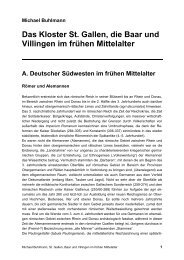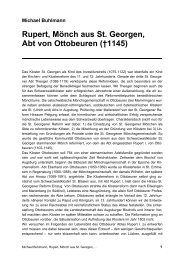Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
gen Honaus waren im 8. Jahrh<strong>und</strong>ert Lautenbach <strong>und</strong> Beromünster.<br />
Isny (Benedikt<strong>in</strong>er)<br />
Die 1042 erstmals erwähnte Kirche <strong>de</strong>r Grafen von Altshausen-Ver<strong>in</strong>gen wur<strong>de</strong> 1096 von<br />
Benedikt<strong>in</strong>ermönchen aus <strong>de</strong>m Kloster Hirsau besie<strong>de</strong>lt. Es entstand e<strong>in</strong> Reformkloster Hirsauer<br />
Prägung, das <strong>de</strong>m Papst unterstellt wur<strong>de</strong> (1106) <strong>und</strong> sich durch Zuwendungen <strong>und</strong><br />
Schenkungen Gr<strong>und</strong>besitz im Allgäu erwarb. Im Rahmen e<strong>in</strong>es „topografischen Dualismus“<br />
entstand neben <strong>de</strong>m Kloster bis vor 1235 die Stadt Isny, aus <strong>de</strong>r <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Folgezeit e<strong>in</strong>e<br />
Reichsstadt wer<strong>de</strong>n sollte. Ause<strong>in</strong>an<strong>de</strong>rsetzungen mit <strong>de</strong>n Truchsessen bzw. Grafen von<br />
Waldburg, <strong>de</strong>n Klostervögten, <strong>und</strong> <strong>de</strong>r während <strong>de</strong>r Reformation evangelisch gewor<strong>de</strong>nen<br />
Stadt Isny brachten das Kloster an <strong>de</strong>n Rand se<strong>in</strong>er Existenz. Erst zu Beg<strong>in</strong>n <strong>de</strong>s 18. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
führten Reformen zu e<strong>in</strong>er Vergrößerung <strong>de</strong>s Mönchskonvents <strong>und</strong> zu e<strong>in</strong>er (zeitweisen)<br />
Stabilisierung <strong>de</strong>r wirtschaftlichen Gr<strong>und</strong>lagen <strong>de</strong>s Klosters. Das R<strong>in</strong>gen um Reichsunmittelbarkeit<br />
<strong>und</strong> Reichsstandschaft en<strong>de</strong>te mit <strong>de</strong>r Anerkennung von Kloster <strong>und</strong> klösterlicher<br />
Lan<strong>de</strong>sherrschaft durch <strong>de</strong>n Kaiser im Jahr 1781. 1802 ist das Kloster aufgehoben wor<strong>de</strong>n.<br />
Kniebis (Franziskaner)<br />
Am stark genutzten Fernweg Augsburg-Straßburg bestand <strong>in</strong> Kniebis vor 1276 e<strong>in</strong> Hospiz<br />
mit e<strong>in</strong>em 1267 von Graf He<strong>in</strong>rich I. von Fürstenberg (v.1245?-1284) zur Kirche erhobenen<br />
Gotteshaus. 1271 sollten hier regulierte Chorherren angesie<strong>de</strong>lt wer<strong>de</strong>n, 1277 f<strong>in</strong><strong>de</strong>n sich <strong>in</strong><br />
Kniebis die Franziskaner. Letztere nahmen 1341 die Benediktregel an <strong>und</strong> unterstellten sich<br />
<strong>de</strong>m Kloster Alpirsbach unter se<strong>in</strong>em Abt Brun Schenk v. Schenkenberg (1337-1377). Vere<strong>in</strong>bart<br />
wur<strong>de</strong> die freie Wahl <strong>de</strong>s Priors durch <strong>de</strong>n Konvent <strong>in</strong> Kniebis, wobei <strong>de</strong>r Alpirsbacher<br />
Abt <strong>de</strong>n Prior e<strong>in</strong>zusetzen hatte. Im Falle e<strong>in</strong>es Fehlverhaltens <strong>de</strong>s Priors konnte <strong>de</strong>r<br />
Abt <strong>de</strong>n Leiter <strong>de</strong>s Priorats auch absetzen. Der Prior hatte Stimme im Mönchskapitel von<br />
Alpirsbach <strong>und</strong> durfte Besitztransaktionen <strong>und</strong> Pfrün<strong>de</strong>nvergaben nur mit Zustimmung <strong>de</strong>s<br />
Abtes durchführen. Wenig ist <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Folgezeit über das Priorat zu erfahren. 1463 <strong>und</strong> nochmals<br />
1513 brannten Kirche <strong>und</strong> Klostergebäu<strong>de</strong> nie<strong>de</strong>r <strong>und</strong> wur<strong>de</strong>n danach wie<strong>de</strong>r aufgebaut.<br />
Kastvögte waren zunächst die Grafen von Fürstenberg, dann mit <strong>de</strong>m Übergang <strong>de</strong>s<br />
fürstenbergischen Dornstetten an die Grafschaft <strong>Württemberg</strong> (1320) die württembergischen<br />
Lan<strong>de</strong>sherren. Herzog Ulrich von <strong>Württemberg</strong> (1498-1550) hob 1535 die Kommunität auf.<br />
Zwischen 1549 <strong>und</strong> 1559 kehrten die Mönche nach Kniebis zurück, danach wur<strong>de</strong> das Priorat<br />
endgültig aufgelöst.<br />
Der Besitz <strong>de</strong>s Priorats lag zwischen oberer Nagold <strong>und</strong> Neckar, im Renchtal, <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Ortenau<br />
<strong>und</strong> im unteren K<strong>in</strong>zigtal. In Dornstetten <strong>und</strong> Bil<strong>de</strong>ch<strong>in</strong>gen hatte die Geme<strong>in</strong>schaft das Kirchenpatronat<br />
<strong>in</strong>ne. Die Kirche <strong>in</strong> Bil<strong>de</strong>ch<strong>in</strong>gen wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>m Priorat 1488 <strong>in</strong>korporiert, Fischereirechte<br />
hatte die Mönchsgeme<strong>in</strong>schaft im Elbachsee <strong>und</strong> im Forbach. Von <strong>de</strong>r ehemaligen<br />
Kirche <strong>de</strong>s Priorats stehen noch e<strong>in</strong>ige Ru<strong>in</strong>en aus hochgotischer Zeit, Reste <strong>de</strong>r Vorhalle,<br />
e<strong>in</strong>e spitzbogige Seitenpforte u.ä.<br />
<strong>Michael</strong> Buhlmann, <strong>Klöster</strong> <strong>und</strong> <strong>Stifte</strong> <strong>in</strong> <strong>Ba<strong>de</strong>n</strong>-<strong>Württemberg</strong> 63