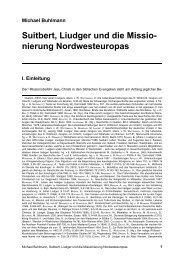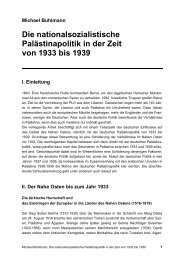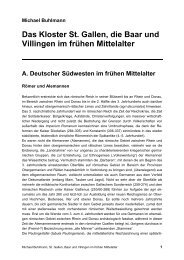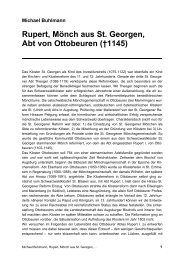Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1428), drangen kirchlich-monastische Reformströmungen <strong>in</strong> Hirsau e<strong>in</strong>. Das Petershauser<br />
Prov<strong>in</strong>zialkapitel von 1417 spielte hier e<strong>in</strong>e Rolle, ebenso E<strong>in</strong>flüsse <strong>de</strong>r Melker Reformbewegung<br />
ab 1424. Doch entschied sich Abt Wolfram Maiser von Berg (1428-1460) letztlich für<br />
die Bursfel<strong>de</strong>r Union, <strong>in</strong> die Hirsau am 9. Oktober 1458 aufgenommen wur<strong>de</strong>. Abt Bernhard<br />
von Gernsbach (1460-1482), <strong>de</strong>r sec<strong>und</strong>us f<strong>und</strong>ator <strong>de</strong>r Mönchsgeme<strong>in</strong>schaft, setzte die von<br />
se<strong>in</strong>en Vorgängern begonnene Erneuerung <strong>de</strong>s Klosterlebens erfolgreich fort. E<strong>in</strong> starker<br />
wirtschaftlicher Aufschwung äußerte sich <strong>in</strong> Neubau <strong>und</strong> Erweiterung <strong>de</strong>r Klostergebäu<strong>de</strong>,<br />
die Zahl <strong>de</strong>r Konventualen nahm zu, die Mönche waren nun nicht mehr nur Nie<strong>de</strong>radlige aus<br />
<strong>de</strong>m Umfeld <strong>de</strong>s Klosters, son<strong>de</strong>rn kamen aus <strong>de</strong>r württembergischen Ehrbarkeit, <strong>de</strong>m Bürgertum<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>n reichen Bauernfamilien. 1493 tagte das benedikt<strong>in</strong>ische Prov<strong>in</strong>zialkapitel <strong>in</strong><br />
Hirsau, <strong>und</strong> Abt Johannes Trithemius von Sponheim (1485-1506) verfasste auf Veranlassung<br />
<strong>de</strong>s Hirsauer Klosterleiters Blasius Scheltrub (1484-1503) <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Folge se<strong>in</strong>e „Hirsauer<br />
Chroniken“.<br />
Diszipl<strong>in</strong> <strong>und</strong> Verfassung <strong>de</strong>s Klosters ließen an <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong> zum 16. Jahrh<strong>und</strong>ert <strong>in</strong><strong>de</strong>s nach.<br />
Es gab aufsässige Mönche, Abt Blasius wur<strong>de</strong> zeitweilig suspendiert, die B<strong>in</strong>dung an die<br />
Bursfel<strong>de</strong>r Union litt. 1525 wur<strong>de</strong> Hirsau vom Bauernkrieg <strong>in</strong> Mitlei<strong>de</strong>nschaft gezogen, 1535<br />
führte Herzog Ulrich von <strong>Württemberg</strong> (1498-1550) als Klostervogt die Reformation e<strong>in</strong>.<br />
Nach Augsburger Interim (1548) <strong>und</strong> Restitutionsedikt (1629) kehrten vorübergehend katholische<br />
Mönche nach Hirsau zurück. 1556 wur<strong>de</strong> das Kloster <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e evangelische Klosterschule<br />
umgewan<strong>de</strong>lt, die Gr<strong>und</strong>herrschaft <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Klosteramt. 1807 wur<strong>de</strong> das Klosteramt aufgelöst.<br />
Überstan<strong>de</strong>n haben die Jahrh<strong>und</strong>erte die Hirsauer Klosterru<strong>in</strong>en <strong>und</strong> -gebäu<strong>de</strong>: die Reste<br />
von Kirche (e<strong>in</strong>schließlich <strong>de</strong>s Eulenturms) <strong>und</strong> Kreuzgang, <strong>de</strong>r spätgotische Bibliothekssaal,<br />
die ebenfalls spätgotische Marienkirche, Reste von Sommerrefektorium <strong>und</strong> Umfassungsmauern.<br />
Hohentwiel (Benedikt<strong>in</strong>er)<br />
Der Hohentwiel war nicht nur Burg <strong>de</strong>s Herzogs von Schwaben, son<strong>de</strong>rn hier entstand wohl<br />
zwischen 968 <strong>und</strong> 973 auf Betreiben Herzogs Burchard III. (954-973) <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er Ehefrau,<br />
<strong>de</strong>r „Herzog<strong>in</strong>“ Hadwig (973-994), auch e<strong>in</strong> eigenständiges Georgskloster benedikt<strong>in</strong>ischer<br />
Ausprägung. Mit <strong>de</strong>m Tod Hadwigs war <strong>de</strong>r Hohentwiel <strong>de</strong>m Zugriff <strong>de</strong>r ottonischen Herrscher<br />
Otto III. (984-1002) <strong>und</strong> He<strong>in</strong>rich II. (1002-1024) preisgegeben. He<strong>in</strong>rich II. verlegte<br />
das Kloster 1005 nach Ste<strong>in</strong> am Rhe<strong>in</strong>, die verlegte Mönchsgeme<strong>in</strong>schaft wur<strong>de</strong> 1007 <strong>de</strong>m<br />
damals vom König gegrün<strong>de</strong>ten Bistum Bamberg unterstellt.<br />
Honau (Schottenmönche, Stift)<br />
Frühen irischen E<strong>in</strong>fluss im <strong>de</strong>utschen Südwesten verrät das auf <strong>de</strong>r Rhe<strong>in</strong><strong>in</strong>sel nördlich von<br />
Straßburg gegrün<strong>de</strong>te Kloster Honau, für das sieben Urk<strong>und</strong>en <strong>de</strong>s elsässischen Herzogs<br />
Adalbert (684/90-722) <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er Verwandten überliefert s<strong>in</strong>d (722-749). Damals leitete e<strong>in</strong><br />
Abtbischof Benedikt das Kloster nach irischer Regel. Dem Nie<strong>de</strong>rgang im 10. folgte die Ausbildung<br />
e<strong>in</strong>es Kanonikerstifts im 11. Jahrh<strong>und</strong>ert, mit Hezel<strong>in</strong> (1047, 1065) ist e<strong>in</strong> Honauer<br />
Propst bezeugt. Das Stift kam 1290 nach Rhe<strong>in</strong>au, 1398 nach Straßburg. Tochtergründun-<br />
<strong>Michael</strong> Buhlmann, <strong>Klöster</strong> <strong>und</strong> <strong>Stifte</strong> <strong>in</strong> <strong>Ba<strong>de</strong>n</strong>-<strong>Württemberg</strong> 62