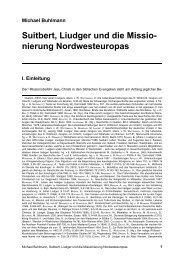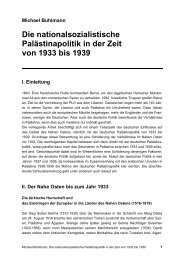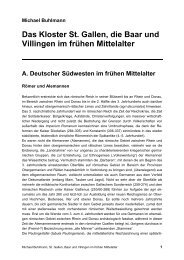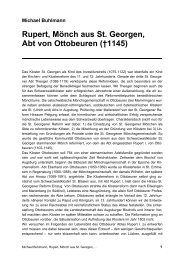Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
e<strong>in</strong> Diplom Kaiser He<strong>in</strong>richs V. (1106-1125) vom 8. Januar 1125 beweist, das <strong>de</strong>m Kloster<br />
Königsschutz <strong>und</strong> freie Vogtwahl zugestand. In <strong>de</strong>r Folge etablierten sich die Zähr<strong>in</strong>ger als<br />
Klostervögte, nach <strong>de</strong>ren Aussterben (1218) wur<strong>de</strong> die Vogtei unter Kaiser Friedrich II.<br />
(1212-1250) Reichslehen, so dass immerh<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e gewisse Anb<strong>in</strong>dung St. Blasiens an das<br />
Reich bestand, ohne dass hier von e<strong>in</strong>em Reichskloster o<strong>de</strong>r von Reichsunmittelbarkeit gere<strong>de</strong>t<br />
wer<strong>de</strong>n kann. Um die Mitte <strong>de</strong>s 13. Jahrh<strong>und</strong>erts s<strong>in</strong>d die Habsburger als Schutz- <strong>und</strong><br />
Kastvögte <strong>de</strong>r Mönchsgeme<strong>in</strong>schaft bezeugt. St. Blasien wur<strong>de</strong> damit zu e<strong>in</strong>em Bestandteil<br />
<strong>de</strong>s vor<strong>de</strong>rösterreichischen Herrschaftsverbands <strong>de</strong>r habsburgischen Herzöge <strong>und</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong>r<br />
frühen Neuzeit als Landstand vor<strong>de</strong>rösterreichisches Prälatenkloster. Trotz<strong>de</strong>m gab es auch<br />
Beziehungen zum Reich, die damit zusammenh<strong>in</strong>gen, dass das Kloster zwischen 1422 <strong>und</strong><br />
1521 <strong>in</strong> <strong>de</strong>n Reichsmatrikeln geführt wur<strong>de</strong> <strong>und</strong> <strong>de</strong>r schwäbische Reichskreis 1549 vergeblich<br />
versuchte, St. Blasien als Reichsprälatenkloster e<strong>in</strong>zub<strong>in</strong><strong>de</strong>n. Immerh<strong>in</strong> waren die vier<br />
seit <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 13. Jahrh<strong>und</strong>ert von St. Blasien erworbenen „Reichsherrschaften“ Blumegg,<br />
Bettmar<strong>in</strong>gen, Gutenburg <strong>und</strong> Berauer Berg Ausgangspunkt für die 1609 konstituierte<br />
reichsunmittelbare Herrschaft Bonndorf.<br />
St. Blasien, das von <strong>de</strong>r Reformation verschont blieb, ist dann 1806 säkularisiert wor<strong>de</strong>n, die<br />
Mönche g<strong>in</strong>gen <strong>in</strong>s österreichische St. Paul im Lavanttal. Von <strong>de</strong>r alten Klosteranlage ist<br />
nichts mehr vorhan<strong>de</strong>n. H<strong>in</strong>gegen ist die barocke Klosteranlage mit <strong>de</strong>r berühmten Kuppelkirche<br />
auch heute noch bee<strong>in</strong>druckend. Unter Abt Mart<strong>in</strong> Gerbert (1764-1793) wur<strong>de</strong> nach<br />
<strong>de</strong>m Klosterbrand von 1768 u.a. die neue Kirche mit ihrer strahlend weißen Rot<strong>und</strong>e unter<br />
<strong>de</strong>r Kirchenkuppel erbaut. Nach <strong>de</strong>r Säkularisation dienten die weitläufigen Konventsgebäu<strong>de</strong><br />
bis 1931 auch als Fabriken, ab 1933 besteht <strong>in</strong> St. Blasien e<strong>in</strong> Jesuitenkolleg mit Internat.<br />
St. Georgen im Schwarzwald (Benedikt<strong>in</strong>er)<br />
In <strong>de</strong>n Anfang <strong>de</strong>s Investiturstreits fällt die Gründung e<strong>in</strong>es Benedikt<strong>in</strong>erklosters auf <strong>de</strong>m<br />
„Scheitel Alemanniens“ im Schwarzwald: Die Mönchsgeme<strong>in</strong>schaft <strong>in</strong> St. Georgen, an <strong>de</strong>r<br />
Quelle <strong>de</strong>r Brigach gelegen, war e<strong>in</strong> Resultat <strong>de</strong>s Zusammengehens von schwäbischem<br />
A<strong>de</strong>l <strong>und</strong> kirchlicher Reformpartei, e<strong>in</strong>drucksvoll repräsentiert durch die Klostergrün<strong>de</strong>r Hezelo<br />
(†1088) <strong>und</strong> Hesso (†1113/14) <strong>und</strong> <strong>de</strong>n Abt <strong>und</strong> Klosterreformer Wilhelm von Hirsau<br />
(1069-1091). Statt <strong>de</strong>s zunächst <strong>in</strong> Aussicht genommenen oberschwäbischen Königseggwald<br />
wur<strong>de</strong> auf Betreiben Wilhelms St. Georgen als Ort <strong>de</strong>r Klostergründung ausgewählt. Mit<br />
<strong>de</strong>r Besiedlung St. Georgens durch Hirsauer Mönche im Frühjahr <strong>und</strong> Sommer 1084 <strong>und</strong> <strong>de</strong>r<br />
Weihe <strong>de</strong>r Klosterkapelle am 24. Juni 1085 nahm die Geschichte <strong>de</strong>s Schwarzwaldklosters<br />
ihren Anfang.<br />
Zunächst hirsauisches Priorat, dann selbstständige Abtei (1086), begann <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Zeit Abt<br />
Theogers (1088-1119) <strong>de</strong>r Aufstieg St. Georgens zu e<strong>in</strong>em <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>utendsten <strong>Klöster</strong><br />
Süd(west)<strong>de</strong>utschlands Hirsauer Prägung. Bis um die Mitte <strong>de</strong>s 12. Jahrh<strong>und</strong>erts vergrößerten<br />
Schenkung, Kauf <strong>und</strong> Tausch von Land <strong>und</strong> Rechten <strong>de</strong>n Besitz <strong>de</strong>s Klosters beträchtlich<br />
<strong>und</strong> schufen damit die materielle Basis klösterlicher Existenz. Die über Schwaben <strong>und</strong><br />
das Elsass reichen<strong>de</strong>, im Raum zwischen Neckar <strong>und</strong> Donau sich verdichten<strong>de</strong> Gr<strong>und</strong>herrschaft<br />
aus Gütern, Besitzkomplexen, abhängigen Bauern, E<strong>in</strong>künften <strong>und</strong> Rechten, auch<br />
über Pfarrkirchen <strong>und</strong> <strong>Klöster</strong>n, sicherte die Versorgung <strong>de</strong>r Mönche, die u.a. <strong>in</strong> Liturgie <strong>und</strong><br />
Gebet <strong>de</strong>m Seelenheil <strong>de</strong>r klösterlichen Wohltäter gedachten. Kloster <strong>und</strong> Klosterbesitz waren<br />
dabei (theoretisch) geschützt durch <strong>de</strong>n Vogt. Die Vogtei übten zunächst <strong>de</strong>r Kloster-<br />
<strong>Michael</strong> Buhlmann, <strong>Klöster</strong> <strong>und</strong> <strong>Stifte</strong> <strong>in</strong> <strong>Ba<strong>de</strong>n</strong>-<strong>Württemberg</strong> 77