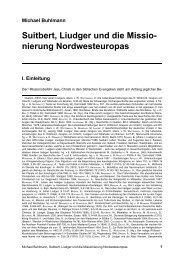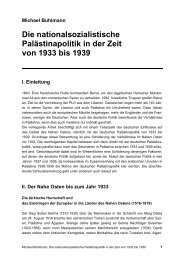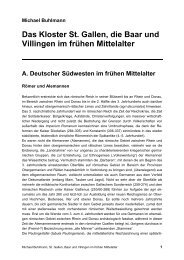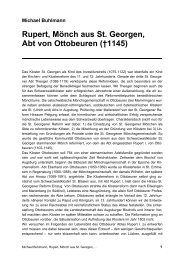Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ung, die die Anzahl <strong>de</strong>r Nonnen wie<strong>de</strong>r steigen ließ. Zwischen 1556 <strong>und</strong> 1582 wur<strong>de</strong> das<br />
Kloster e<strong>in</strong> Opfer <strong>de</strong>r württembergischen Reformation.<br />
Maulbronn (Zisterzienser)<br />
Aus e<strong>in</strong>er „Gründungsurk<strong>und</strong>e“ <strong>de</strong>s Speyerer Bischofs Gunther (1146-1161) von 1148 erfahren<br />
wir e<strong>in</strong>iges über die Entstehung <strong>de</strong>r Zisterze Maulbronn. Initiator <strong>de</strong>r Gründung war e<strong>in</strong><br />
E<strong>de</strong>lfreier namens Walter von Lomersheim, auf <strong>de</strong>ssen Bitten Abt Ulrich vom Neuburger Zisterzienserkloster<br />
auf Walters Erbgut <strong>in</strong> Eckenweiher e<strong>in</strong>e Mönchsgeme<strong>in</strong>schaft grün<strong>de</strong>te<br />
(1138/39). Doch genügte Eckenweiher <strong>de</strong>n Erfor<strong>de</strong>rnissen e<strong>in</strong>es Klosters nicht, so dass die<br />
Mönchsgeme<strong>in</strong>schaft mit Unterstützung <strong>de</strong>s Bischofs von Speyer nach Maulbronn verlegt<br />
wur<strong>de</strong> (1147). E<strong>in</strong>e Bulle Papst Eugens III. (1145-1153) vom 29. März 1148 privilegierte<br />
schon bald das Kloster, das sich <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Folgezeit trotz angespannter Wirtschaftslage <strong>und</strong><br />
trotz e<strong>in</strong>es bestehen<strong>de</strong>n Gegensatzes zwischen staufischen <strong>und</strong> welfischen Parteigängern<br />
etablieren konnte. Die <strong>de</strong>fensio, die „Verteidigung“ <strong>de</strong>s Klosters kam dabei <strong>in</strong> bischöfliche<br />
Hand, die geistliche Geme<strong>in</strong>schaft fand sich e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en <strong>in</strong> das Netzwerk <strong>de</strong>r Stauferanhänger<br />
nördlich <strong>de</strong>r Enz, von <strong>de</strong>nen Bischof Gunther <strong>de</strong>r prom<strong>in</strong>enteste war. Die Schutzurk<strong>und</strong>e<br />
Kaiser Friedrichs I. (1152-1190) vom 8. Januar 1156 kann dann als vorläufiger Endpunkt<br />
<strong>de</strong>r Integration Maulbronns <strong>in</strong> das staufische Herrschaftssystem gelten. Besitzvergrößerung<br />
<strong>und</strong> Rodungstätigkeiten verbesserten unter<strong>de</strong>ssen die wirtschaftliche Situation <strong>de</strong>r<br />
Zisterze, die beispielsweise 1159 massiv gegen die Bewohner <strong>de</strong>s Dorfes Eilf<strong>in</strong>gen vorg<strong>in</strong>g,<br />
um dort e<strong>in</strong>e Grangie zu errichten.<br />
Mit <strong>de</strong>m Tod Bischof Gunthers hörten die engen Beziehungen Maulbronns zum Speyerer<br />
Bistum auf, das Kloster stand während <strong>de</strong>s alexandr<strong>in</strong>ischen Papstschismas (1159-1177) auf<br />
staufischer Seite, <strong>de</strong>r Bischof übte wohl im Auftrag <strong>de</strong>s Kaisers die <strong>de</strong>fensio über die<br />
Mönchsgeme<strong>in</strong>schaft aus. Nach <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>n von Venedig (1177) erlangte das Kloster zwei<br />
Papstprivilegien vom 21. Dezember 1177 <strong>und</strong> April 1179. Maulbronner Äbte stan<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong>r<br />
Folgezeit weiterh<strong>in</strong> <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit <strong>de</strong>n staufischen Kaisern <strong>und</strong> Königen, die <strong>de</strong>utschen<br />
Herrscher übten die Schirmvogtei über das Kloster aus, als diesbezügliche Amtsträger s<strong>in</strong>d<br />
wohl ab 1236 die Herren von Niefern-Enzberg, e<strong>in</strong> staufisches M<strong>in</strong>isterialengeschlecht, neben<br />
<strong>de</strong>m Reichsvogt von Wimpfen (1240/43) bezeugt. In spät- <strong>und</strong> nachstaufischer Zeit gerieten<br />
die Reichsrechte gegenüber Maulbronn bald <strong>in</strong>s H<strong>in</strong>tertreffen. Gemäß e<strong>in</strong>em Diplom<br />
König Wilhelms von Holland (1247-1256) vom 23. März 1255 durfte <strong>de</strong>r Bischof von Speyer<br />
<strong>de</strong>n Schirmvogt über die Zisterze e<strong>in</strong>setzen, doch konnten die Herren von Enzberg, die die<br />
Schutzvogtei rücksichtslos ausübten, erst 1270 aus <strong>de</strong>r klösterlichen <strong>de</strong>fensio verdrängt<br />
wer<strong>de</strong>n. 1273 gelangte die Vogtei nochmals ans Reich, ab 1280 übte <strong>de</strong>r Speyerer Bischof<br />
die <strong>de</strong>fensio <strong>in</strong> königlichem Auftrag aus. Die Vogtei wur<strong>de</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong>n 1360er-Jahren kurpfälzisch,<br />
1504 württembergisch. Das 1554 endgültig evangelisch gewor<strong>de</strong>ne Kloster g<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>sherrschaft<br />
<strong>de</strong>r württembergischen Herzöge auf.<br />
Die Klosterkultur Maulbronns bewegte sich mit Skriptorium <strong>und</strong> Büchern im Umfeld <strong>de</strong>r Kultur<br />
<strong>de</strong>s Zisterziensertums. Das zisterziensische „Gr<strong>und</strong>gesetz“ <strong>de</strong>r charta caritatis („Urk<strong>und</strong>e<br />
<strong>de</strong>r Liebe“, endgültige Redaktion <strong>in</strong> <strong>de</strong>n 1160er-Jahren) schrieb so e<strong>in</strong>en gewissen M<strong>in</strong><strong>de</strong>ststandard<br />
<strong>in</strong> Quantität <strong>und</strong> Qualität <strong>de</strong>r im Kloster zu benutzen<strong>de</strong>n (liturgischen) Bücher vor,<br />
die damit klösterliche Lebenspraxis untermauern halfen. Das Maulbronner Antiphonar <strong>de</strong>s<br />
Jahres 1249 aus <strong>de</strong>m Kloster Lichtenthal verweist dann direkt auf die damalige zisterziensi-<br />
<strong>Michael</strong> Buhlmann, <strong>Klöster</strong> <strong>und</strong> <strong>Stifte</strong> <strong>in</strong> <strong>Ba<strong>de</strong>n</strong>-<strong>Württemberg</strong> 67