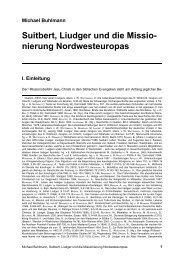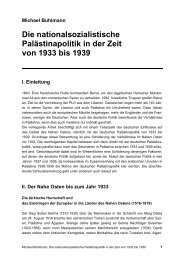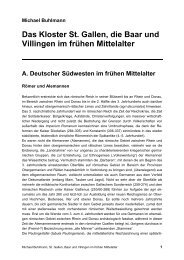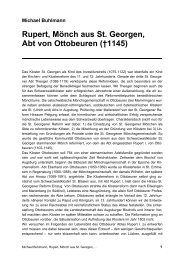Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
die württembergischen Territorialherren betrachteten seit <strong>de</strong>r 2. Hälfte <strong>de</strong>s 15. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
das Kloster St. Georgen als Teil ihrer Lan<strong>de</strong>sherrschaft. Ab 1491 wur<strong>de</strong>n die Reichsmatrikel,<br />
also die seit 1422/27 von <strong>de</strong>n Reichsstän<strong>de</strong>n <strong>und</strong> Territorien aufzubr<strong>in</strong>gen<strong>de</strong>n Leistungen<br />
zur Reichsverteidigung, zu <strong>de</strong>nen auch St. Georgen veranlagt wur<strong>de</strong>, von <strong>Württemberg</strong> e<strong>in</strong>gezogen,<br />
während vor diesem Jahr die unmittelbar vom Kloster an das Reich gegangenen<br />
Matrikel zum<strong>in</strong><strong>de</strong>st Ausdruck e<strong>in</strong>es engeren Verhältnisses <strong>de</strong>s Klosters zum König bzw. Kaiser<br />
waren, auch eigene Herrschaftsrechte <strong>de</strong>s Abtes voraussetzten. Doch soll sich <strong>de</strong>r Abt<br />
auf <strong>de</strong>n Reichstagen durch <strong>de</strong>n <strong>Württemberg</strong>er Grafen haben vertreten lassen. Gera<strong>de</strong> die<br />
Vertretung bei Reichsmatrikel <strong>und</strong> Reichstag spiegelt aber die Landsässigkeit <strong>de</strong>s Schwarzwaldklosters<br />
<strong>in</strong>nerhalb <strong>de</strong>s württembergischen Territorialverban<strong>de</strong>s wi<strong>de</strong>r. Die Mönchsgeme<strong>in</strong>schaft<br />
war auf <strong>de</strong>m Weg, e<strong>in</strong> Landstand zu wer<strong>de</strong>n, <strong>und</strong> war es, als es 1481 zur württembergischen<br />
Lan<strong>de</strong>se<strong>in</strong>igung kam o<strong>de</strong>r 1498 zu e<strong>in</strong>em Stuttgarter Landtag. Trotz Landsässigkeit<br />
blieben aber die Beziehungen <strong>de</strong>s Klosters zum Königtum erhalten, wie die Privilegien<br />
vom 21. August 1507 <strong>und</strong> vom 24. Mai 1521 beweisen.<br />
Reichsprälatenklöster <strong>in</strong> Oberschwaben. H<strong>in</strong>gegen konnten sich gera<strong>de</strong> <strong>in</strong> Oberschwa-<br />
ben Mönchs- <strong>und</strong> Nonnenkonvente <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er reichsunmittelbaren Selbstständigkeit behaupten.<br />
Als Reichsstand waren diese Reichsprälatenklöster <strong>in</strong> <strong>de</strong>r frühen Neuzeit auf <strong>de</strong>m (Regensburger)<br />
Reichstag <strong>und</strong> <strong>de</strong>m Kreistag <strong>de</strong>s schwäbischen Kreises vertreten. Sie bestimmten<br />
auf Gr<strong>und</strong> ihrer ger<strong>in</strong>gen (militärischen, f<strong>in</strong>anziellen) Leistungskraft (Reichsmatrikel) <strong>in</strong><br />
nur ebenso ger<strong>in</strong>gem Maße die Politik <strong>in</strong> Kreis <strong>und</strong> Reich mit, waren aber <strong>de</strong>r katholischen<br />
Sache verb<strong>und</strong>en <strong>und</strong> somit Kaiser <strong>und</strong> Reich. Auf <strong>de</strong>r Ebene <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>sherrschaften <strong>und</strong><br />
Territorien bestan<strong>de</strong>n teilweise Abhängigkeiten, u.a. von <strong>de</strong>n Habsburgern <strong>und</strong> <strong>de</strong>r kaiserlichen<br />
Landvogtei Oberschwaben. Infolge<strong>de</strong>ssen wur<strong>de</strong> die politisch-wirt-schaftliche Lage<br />
mancher oberschwäbischer <strong>Klöster</strong> im Verlauf <strong>de</strong>s 18. Jahrh<strong>und</strong>erts immer prekärer, so dass<br />
die Säkularisation, die je<strong>de</strong> dieser Institutionen am Anfang <strong>de</strong>s 19. Jahrh<strong>und</strong>erts zum Opfer<br />
fiel, fast schon folgerichtig ersche<strong>in</strong>t. Zu <strong>de</strong>n oberschwäbischen Reichsprälaten- <strong>und</strong><br />
-prälat<strong>in</strong>nenklöstern gehörten u.a. die Benedikt<strong>in</strong>erabteien We<strong>in</strong>garten, Isny, Zwiefalten <strong>und</strong><br />
Ochsenhausen, die Prämonstratenserstifte Obermarchtal, Weißenau <strong>und</strong> Schussenried, die<br />
Zisterzienser- <strong>und</strong> beson<strong>de</strong>rs Zisterzienser<strong>in</strong>nenabteien Salem, Ba<strong>in</strong>dt, Gutenzell <strong>und</strong> Heggbach,<br />
das August<strong>in</strong>erchorherrenstift Beuron, das Klarissenkloster Söfl<strong>in</strong>gen.<br />
Klosterreformen<br />
Früh- <strong>und</strong> Hochmittelalter. Reform be<strong>de</strong>utet im mittelalterlichen S<strong>in</strong>n die Wie<strong>de</strong>rherstellung<br />
e<strong>in</strong>es ursprünglichen, als erstrebenswert angesehenen Zustands. Während <strong>de</strong>s gesamten<br />
Mittelalters gab es Phasen <strong>de</strong>r Klosterreform. Erstmals erstrebten die karol<strong>in</strong>gischen Frankenkönige<br />
Karl <strong>de</strong>r Große (768-814) <strong>und</strong> Ludwig <strong>de</strong>r Fromme (814-840) e<strong>in</strong>e Vere<strong>in</strong>heitlichung<br />
<strong>de</strong>s Klosterwesens. Die „allgeme<strong>in</strong>e Ermahnung“ (admonitio generalis, 789) <strong>und</strong> die<br />
Beschlüsse <strong>de</strong>r Aachener Syno<strong>de</strong> (816) gehörten zur Durchsetzung <strong>de</strong>s Benedikt<strong>in</strong>ertums<br />
ebenso wie die Reformmaßnahmen <strong>de</strong>s Benedikt von Aniane (*ca.750-†821). Im 10. <strong>und</strong> 11.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert vermittelte u.a. auf <strong>de</strong>r Reichenau die Klosterreform <strong>de</strong>s lothr<strong>in</strong>gischen Gorze<br />
Impulse („Reichsmönchtum“), während die Mönchsgeme<strong>in</strong>schaft im 910 gegrün<strong>de</strong>ten Cluny<br />
mit ihren angeschlossenen <strong>Klöster</strong>n cluniazenischer Observanz <strong>und</strong> <strong>de</strong>m Fehlen eigenkirchlicher<br />
Strukturen bei e<strong>in</strong>em als i<strong>de</strong>ell angesehenen päpstlichen Schutz von Burg<strong>und</strong> aus<br />
<strong>Michael</strong> Buhlmann, <strong>Klöster</strong> <strong>und</strong> <strong>Stifte</strong> <strong>in</strong> <strong>Ba<strong>de</strong>n</strong>-<strong>Württemberg</strong> 39