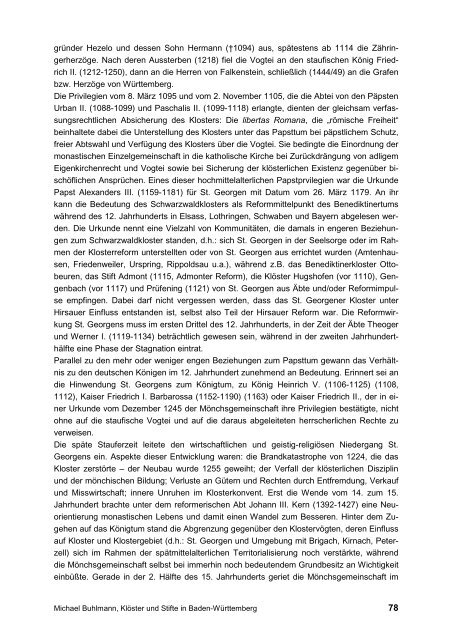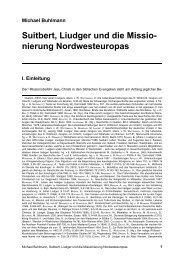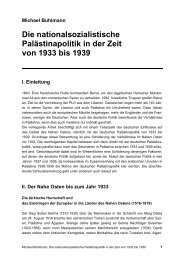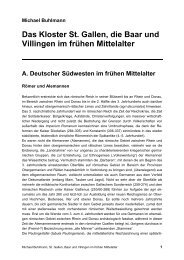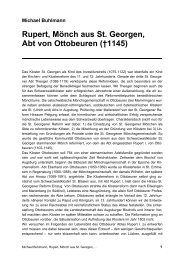Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
grün<strong>de</strong>r Hezelo <strong>und</strong> <strong>de</strong>ssen Sohn Hermann (†1094) aus, spätestens ab 1114 die Zähr<strong>in</strong>gerherzöge.<br />
Nach <strong>de</strong>ren Aussterben (1218) fiel die Vogtei an <strong>de</strong>n staufischen König Friedrich<br />
II. (1212-1250), dann an die Herren von Falkenste<strong>in</strong>, schließlich (1444/49) an die Grafen<br />
bzw. Herzöge von <strong>Württemberg</strong>.<br />
Die Privilegien vom 8. März 1095 <strong>und</strong> vom 2. November 1105, die die Abtei von <strong>de</strong>n Päpsten<br />
Urban II. (1088-1099) <strong>und</strong> Paschalis II. (1099-1118) erlangte, dienten <strong>de</strong>r gleichsam verfassungsrechtlichen<br />
Absicherung <strong>de</strong>s Klosters: Die libertas Romana, die „römische Freiheit“<br />
be<strong>in</strong>haltete dabei die Unterstellung <strong>de</strong>s Klosters unter das Papsttum bei päpstlichem Schutz,<br />
freier Abtswahl <strong>und</strong> Verfügung <strong>de</strong>s Klosters über die Vogtei. Sie bed<strong>in</strong>gte die E<strong>in</strong>ordnung <strong>de</strong>r<br />
monastischen E<strong>in</strong>zelgeme<strong>in</strong>schaft <strong>in</strong> die katholische Kirche bei Zurückdrängung von adligem<br />
Eigenkirchenrecht <strong>und</strong> Vogtei sowie bei Sicherung <strong>de</strong>r klösterlichen Existenz gegenüber bischöflichen<br />
Ansprüchen. E<strong>in</strong>es dieser hochmittelalterlichen Papstprvilegien war die Urk<strong>und</strong>e<br />
Papst Alexan<strong>de</strong>rs III. (1159-1181) für St. Georgen mit Datum vom 26. März 1179. An ihr<br />
kann die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Schwarzwaldklosters als Reformmittelpunkt <strong>de</strong>s Benedikt<strong>in</strong>ertums<br />
während <strong>de</strong>s 12. Jahrh<strong>und</strong>erts <strong>in</strong> Elsass, Lothr<strong>in</strong>gen, Schwaben <strong>und</strong> Bayern abgelesen wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Urk<strong>und</strong>e nennt e<strong>in</strong>e Vielzahl von Kommunitäten, die damals <strong>in</strong> engeren Beziehungen<br />
zum Schwarzwaldkloster stan<strong>de</strong>n, d.h.: sich St. Georgen <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Seelsorge o<strong>de</strong>r im Rahmen<br />
<strong>de</strong>r Klosterreform unterstellten o<strong>de</strong>r von St. Georgen aus errichtet wur<strong>de</strong>n (Amtenhausen,<br />
Frie<strong>de</strong>nweiler, Urspr<strong>in</strong>g, Rippoldsau u.a.), während z.B. das Benedikt<strong>in</strong>erkloster Ottobeuren,<br />
das Stift Admont (1115, Admonter Reform), die <strong>Klöster</strong> Hugshofen (vor 1110), Gengenbach<br />
(vor 1117) <strong>und</strong> Prüfen<strong>in</strong>g (1121) von St. Georgen aus Äbte <strong>und</strong>/o<strong>de</strong>r Reformimpulse<br />
empf<strong>in</strong>gen. Dabei darf nicht vergessen wer<strong>de</strong>n, dass das St. Georgener Kloster unter<br />
Hirsauer E<strong>in</strong>fluss entstan<strong>de</strong>n ist, selbst also Teil <strong>de</strong>r Hirsauer Reform war. Die Reformwirkung<br />
St. Georgens muss im ersten Drittel <strong>de</strong>s 12. Jahrh<strong>und</strong>erts, <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>r Äbte Theoger<br />
<strong>und</strong> Werner I. (1119-1134) beträchtlich gewesen se<strong>in</strong>, während <strong>in</strong> <strong>de</strong>r zweiten Jahrh<strong>und</strong>erthälfte<br />
e<strong>in</strong>e Phase <strong>de</strong>r Stagnation e<strong>in</strong>trat.<br />
Parallel zu <strong>de</strong>n mehr o<strong>de</strong>r weniger engen Beziehungen zum Papsttum gewann das Verhältnis<br />
zu <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Königen im 12. Jahrh<strong>und</strong>ert zunehmend an Be<strong>de</strong>utung. Er<strong>in</strong>nert sei an<br />
die H<strong>in</strong>wendung St. Georgens zum Königtum, zu König He<strong>in</strong>rich V. (1106-1125) (1108,<br />
1112), Kaiser Friedrich I. Barbarossa (1152-1190) (1163) o<strong>de</strong>r Kaiser Friedrich II., <strong>de</strong>r <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
Urk<strong>und</strong>e vom Dezember 1245 <strong>de</strong>r Mönchsgeme<strong>in</strong>schaft ihre Privilegien bestätigte, nicht<br />
ohne auf die staufische Vogtei <strong>und</strong> auf die daraus abgeleiteten herrscherlichen Rechte zu<br />
verweisen.<br />
Die späte Stauferzeit leitete <strong>de</strong>n wirtschaftlichen <strong>und</strong> geistig-religiösen Nie<strong>de</strong>rgang St.<br />
Georgens e<strong>in</strong>. Aspekte dieser Entwicklung waren: die Brandkatastrophe von 1224, die das<br />
Kloster zerstörte – <strong>de</strong>r Neubau wur<strong>de</strong> 1255 geweiht; <strong>de</strong>r Verfall <strong>de</strong>r klösterlichen Diszipl<strong>in</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>r mönchischen Bildung; Verluste an Gütern <strong>und</strong> Rechten durch Entfremdung, Verkauf<br />
<strong>und</strong> Misswirtschaft; <strong>in</strong>nere Unruhen im Klosterkonvent. Erst die Wen<strong>de</strong> vom 14. zum 15.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert brachte unter <strong>de</strong>m reformerischen Abt Johann III. Kern (1392-1427) e<strong>in</strong>e Neuorientierung<br />
monastischen Lebens <strong>und</strong> damit e<strong>in</strong>en Wan<strong>de</strong>l zum Besseren. H<strong>in</strong>ter <strong>de</strong>m Zugehen<br />
auf das Königtum stand die Abgrenzung gegenüber <strong>de</strong>n Klostervögten, <strong>de</strong>ren E<strong>in</strong>fluss<br />
auf Kloster <strong>und</strong> Klostergebiet (d.h.: St. Georgen <strong>und</strong> Umgebung mit Brigach, Kirnach, Peterzell)<br />
sich im Rahmen <strong>de</strong>r spätmittelalterlichen Territorialisierung noch verstärkte, während<br />
die Mönchsgeme<strong>in</strong>schaft selbst bei immerh<strong>in</strong> noch be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>m Gr<strong>und</strong>besitz an Wichtigkeit<br />
e<strong>in</strong>büßte. Gera<strong>de</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong>r 2. Hälfte <strong>de</strong>s 15. Jahrh<strong>und</strong>erts geriet die Mönchsgeme<strong>in</strong>schaft im<br />
<strong>Michael</strong> Buhlmann, <strong>Klöster</strong> <strong>und</strong> <strong>Stifte</strong> <strong>in</strong> <strong>Ba<strong>de</strong>n</strong>-<strong>Württemberg</strong> 78