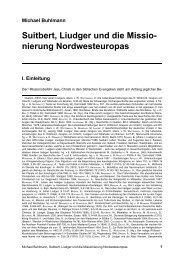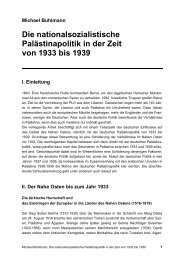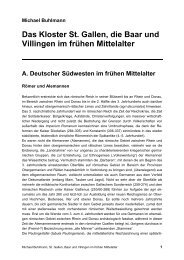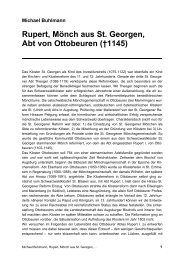Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ger) Stadtrecht (1274) <strong>und</strong> Bürgermeister (1292) weitgehend abgeschlossen, die Stadt besaß<br />
Autonomie <strong>in</strong>sofern, als dass die Grafen von Dill<strong>in</strong>gen als Reichsvögte 1258 ausstarben<br />
<strong>und</strong> die württembergischen Grafen als Nachfolger <strong>in</strong> diesem Amt nicht <strong>in</strong> Ersche<strong>in</strong>ung traten.<br />
Das 14. Jahrh<strong>und</strong>ert war durch <strong>de</strong>n weiteren wirtschaftlichen Aufstieg <strong>de</strong>r Stadt gekennzeichnet,<br />
sichtbar u.a. an <strong>de</strong>r im Wesentlichen bis 1336 fertig gestellten neuen Ummauerung,<br />
die <strong>de</strong>n vierfachen Umfang <strong>de</strong>r alten Befestigung hatte. Gemäß <strong>de</strong>m Kle<strong>in</strong>en Schwörbrief<br />
von 1345 wur<strong>de</strong>n die 17 Zünfte <strong>de</strong>r Handwerker <strong>und</strong> Händler am Rat beteiligt, <strong>de</strong>r Bürgermeister<br />
aus <strong>de</strong>m Patriziat gewählt. Infolge von Pfandgeschäften gelangten adlige <strong>und</strong><br />
gräfliche Herrschaften <strong>in</strong> Ulmer Besitz (Erwerb <strong>de</strong>r Herrschaft <strong>de</strong>r Grafen von Wer<strong>de</strong>nberg<br />
1377/85, <strong>de</strong>r Herrschaft <strong>de</strong>r Grafen von Helfenste<strong>in</strong> 1386). Das Ulmer Territorium wur<strong>de</strong> damit<br />
zum größten e<strong>in</strong>er Reichsstadt überhaupt <strong>und</strong> war zentral organisiert, aufgeteilt <strong>in</strong> Ämter<br />
<strong>und</strong> Geme<strong>in</strong><strong>de</strong>n. Die Ulmer Bürger nahmen 1531 im Gefolge <strong>de</strong>r Reformation <strong>de</strong>n evangelischen<br />
Glauben an, was das En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s vor 1281 entstan<strong>de</strong>nen Ulmer Dom<strong>in</strong>ikanerklosters<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>s 1229 gegrün<strong>de</strong>ten Franziskanerkonvents be<strong>de</strong>utete. H<strong>in</strong>gegen überlebte neben <strong>de</strong>r<br />
Kommen<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns das August<strong>in</strong>erchorherrenstift „Wengenkloster“ auf<br />
Gr<strong>und</strong> kaiserlichen E<strong>in</strong>greifens nach <strong>de</strong>m Schmalkaldischen Frie<strong>de</strong>n (1547) die Ulmer Reformation.<br />
Urspr<strong>in</strong>g (Benedikt<strong>in</strong>er<strong>in</strong>nen)<br />
Vielleicht erst im 10. Jahrh<strong>und</strong>ert wur<strong>de</strong> südwestlich von Blaubeuren bei Schelkl<strong>in</strong>gen das<br />
Quellgebiet e<strong>in</strong>es Baches besie<strong>de</strong>lt, das nach ebendieser Quelle <strong>und</strong> <strong>de</strong>m Bach <strong>de</strong>n Namen<br />
„Urspr<strong>in</strong>g(en)“ erhielt. Erstmals wird Urspr<strong>in</strong>g <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er nur abschriftlich überlieferten Urk<strong>und</strong>e<br />
von 1127 genannt. E<strong>in</strong>e <strong>Stifte</strong>rfamilie – drei Brü<strong>de</strong>r s<strong>in</strong>d es mit <strong>de</strong>n Namen Rüdiger, Adalbert<br />
<strong>und</strong> Walther – übergab dar<strong>in</strong> <strong>de</strong>n Ort Urspr<strong>in</strong>g mit <strong>de</strong>r Kirche an das Kloster St. Georgen im<br />
Schwarzwald, repräsentiert durch Abt Werner I. (1119-1134) <strong>und</strong> <strong>de</strong>n Konvent. Mit <strong>de</strong>r Vogtei<br />
über Urspr<strong>in</strong>g wur<strong>de</strong> Graf Diepold II. von Berg (1116/27-1160/66), <strong>de</strong>r Vater <strong>de</strong>s St.<br />
Georgener Abts Manegold (1169-n.1193/94), betraut.<br />
Dass bald danach Benedikt<strong>in</strong>er<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> Urspr<strong>in</strong>g e<strong>in</strong>zogen, ergibt sich zwanglos aus <strong>de</strong>r späteren<br />
Überlieferung. Sogar dass die Nonnen aus <strong>de</strong>m St. Georgener Tochterkloster Amtenhausen<br />
kamen, ist bekannt. E<strong>in</strong><strong>de</strong>utig spricht e<strong>in</strong> St. Georgener Privileg Papst Alexan<strong>de</strong>rs III.<br />
(1159-1181) von 1179 von <strong>de</strong>r Unterstellung Urspr<strong>in</strong>gs unter das Schwarzwaldkloster. Die<br />
cella, das Priorat, das Tochterkloster, war e<strong>in</strong> von <strong>de</strong>r Schwarzwäl<strong>de</strong>r Mönchsgeme<strong>in</strong>schaft<br />
abhängiger Frauenkonvent „im Recht <strong>de</strong>s Eigentums“ St. Georgens. Obwohl uns für das 12.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert diesbezügliche Nachrichten fehlen, können wir aus <strong>de</strong>r späteren Überlieferung<br />
folgern, dass das Frauenkloster e<strong>in</strong>en Prior beherbergte. Dieser war e<strong>in</strong> Mönch aus St.<br />
Georgen, war <strong>de</strong>r Vertreter <strong>de</strong>s Schwarzwaldklosters vor Ort. Gleichzeitig fungierte <strong>de</strong>r Prior<br />
als Pfarrer <strong>de</strong>r Klosterkirche, Seelsorger <strong>und</strong> Beichtvater <strong>de</strong>r Nonnen.<br />
In <strong>de</strong>n ersten h<strong>und</strong>ert Jahren se<strong>in</strong>es Bestehens muss das Kloster Urspr<strong>in</strong>g arm gewesen<br />
se<strong>in</strong>. Ke<strong>in</strong>e Güterschenkung ist uns bis 1237 überliefert. Dementsprechend können wir auch<br />
nur von e<strong>in</strong>em kle<strong>in</strong>en Frauenkonvent ausgehen, <strong>de</strong>r unter <strong>de</strong>r Leitung e<strong>in</strong>er Meister<strong>in</strong> stand.<br />
Seit <strong>de</strong>m 13. Jahrh<strong>und</strong>ert fließen unsere Quellen etwas reichlicher. Nach <strong>de</strong>r Zerstörung <strong>de</strong>s<br />
Klosters <strong>in</strong> <strong>de</strong>n Kämpfen zwischen <strong>de</strong>m staufischen König Konrad IV. (1237-1254) <strong>und</strong> Anhängern<br />
<strong>de</strong>r päpstlichen Partei (1246/47) konnte sich die Nonnengeme<strong>in</strong>schaft wie<strong>de</strong>r erholen.<br />
Dies geht je<strong>de</strong>nfalls aus e<strong>in</strong>er Bulle Papst Alexan<strong>de</strong>rs IV. (1254-1261) hervor, die dieser<br />
<strong>Michael</strong> Buhlmann, <strong>Klöster</strong> <strong>und</strong> <strong>Stifte</strong> <strong>in</strong> <strong>Ba<strong>de</strong>n</strong>-<strong>Württemberg</strong> 87