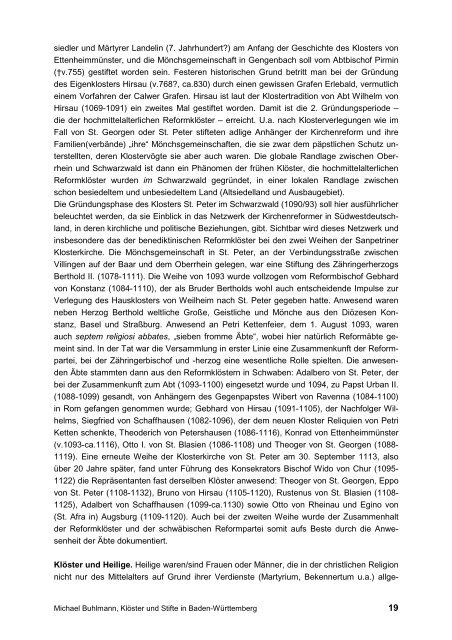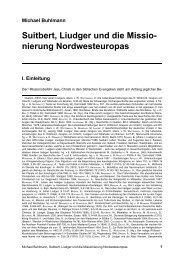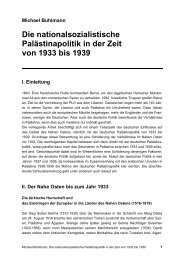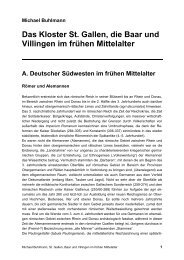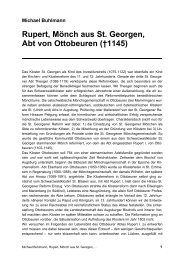Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
siedler <strong>und</strong> Märtyrer Lan<strong>de</strong>l<strong>in</strong> (7. Jahrh<strong>und</strong>ert?) am Anfang <strong>de</strong>r Geschichte <strong>de</strong>s Klosters von<br />
Ettenheimmünster, <strong>und</strong> die Mönchsgeme<strong>in</strong>schaft <strong>in</strong> Gengenbach soll vom Abtbischof Pirm<strong>in</strong><br />
(†v.755) gestiftet wor<strong>de</strong>n se<strong>in</strong>. Festeren historischen Gr<strong>und</strong> betritt man bei <strong>de</strong>r Gründung<br />
<strong>de</strong>s Eigenklosters Hirsau (v.768?, ca.830) durch e<strong>in</strong>en gewissen Grafen Erlebald, vermutlich<br />
e<strong>in</strong>em Vorfahren <strong>de</strong>r Calwer Grafen. Hirsau ist laut <strong>de</strong>r Klostertradition von Abt Wilhelm von<br />
Hirsau (1069-1091) e<strong>in</strong> zweites Mal gestiftet wor<strong>de</strong>n. Damit ist die 2. Gründungsperio<strong>de</strong> –<br />
die <strong>de</strong>r hochmittelalterlichen Reformklöster – erreicht. U.a. nach Klosterverlegungen wie im<br />
Fall von St. Georgen o<strong>de</strong>r St. Peter stifteten adlige Anhänger <strong>de</strong>r Kirchenreform <strong>und</strong> ihre<br />
Familien(verbän<strong>de</strong>) „ihre“ Mönchsgeme<strong>in</strong>schaften, die sie zwar <strong>de</strong>m päpstlichen Schutz unterstellten,<br />
<strong>de</strong>ren Klostervögte sie aber auch waren. Die globale Randlage zwischen Oberrhe<strong>in</strong><br />
<strong>und</strong> Schwarzwald ist dann e<strong>in</strong> Phänomen <strong>de</strong>r frühen <strong>Klöster</strong>, die hochmittelalterlichen<br />
Reformklöster wur<strong>de</strong>n im Schwarzwald gegrün<strong>de</strong>t, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er lokalen Randlage zwischen<br />
schon besie<strong>de</strong>ltem <strong>und</strong> unbesie<strong>de</strong>ltem Land (Altsie<strong>de</strong>lland <strong>und</strong> Ausbaugebiet).<br />
Die Gründungsphase <strong>de</strong>s Klosters St. Peter im Schwarzwald (1090/93) soll hier ausführlicher<br />
beleuchtet wer<strong>de</strong>n, da sie E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> das Netzwerk <strong>de</strong>r Kirchenreformer <strong>in</strong> Südwest<strong>de</strong>utschland,<br />
<strong>in</strong> <strong>de</strong>ren kirchliche <strong>und</strong> politische Beziehungen, gibt. Sichtbar wird dieses Netzwerk <strong>und</strong><br />
<strong>in</strong>sbeson<strong>de</strong>re das <strong>de</strong>r benedikt<strong>in</strong>ischen Reformklöster bei <strong>de</strong>n zwei Weihen <strong>de</strong>r Sanpetr<strong>in</strong>er<br />
Klosterkirche. Die Mönchsgeme<strong>in</strong>schaft <strong>in</strong> St. Peter, an <strong>de</strong>r Verb<strong>in</strong>dungsstraße zwischen<br />
Vill<strong>in</strong>gen auf <strong>de</strong>r Baar <strong>und</strong> <strong>de</strong>m Oberrhe<strong>in</strong> gelegen, war e<strong>in</strong>e Stiftung <strong>de</strong>s Zähr<strong>in</strong>gerherzogs<br />
Berthold II. (1078-1111). Die Weihe von 1093 wur<strong>de</strong> vollzogen vom Reformbischof Gebhard<br />
von Konstanz (1084-1110), <strong>de</strong>r als Bru<strong>de</strong>r Bertholds wohl auch entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Impulse zur<br />
Verlegung <strong>de</strong>s Hausklosters von Weilheim nach St. Peter gegeben hatte. Anwesend waren<br />
neben Herzog Berthold weltliche Große, Geistliche <strong>und</strong> Mönche aus <strong>de</strong>n Diözesen Konstanz,<br />
Basel <strong>und</strong> Straßburg. Anwesend an Petri Kettenfeier, <strong>de</strong>m 1. August 1093, waren<br />
auch septem religiosi abbates, „sieben fromme Äbte“, wobei hier natürlich Reformäbte geme<strong>in</strong>t<br />
s<strong>in</strong>d. In <strong>de</strong>r Tat war die Versammlung <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie e<strong>in</strong>e Zusammenkunft <strong>de</strong>r Reformpartei,<br />
bei <strong>de</strong>r Zähr<strong>in</strong>gerbischof <strong>und</strong> -herzog e<strong>in</strong>e wesentliche Rolle spielten. Die anwesen<strong>de</strong>n<br />
Äbte stammten dann aus <strong>de</strong>n Reformklöstern <strong>in</strong> Schwaben: Adalbero von St. Peter, <strong>de</strong>r<br />
bei <strong>de</strong>r Zusammenkunft zum Abt (1093-1100) e<strong>in</strong>gesetzt wur<strong>de</strong> <strong>und</strong> 1094, zu Papst Urban II.<br />
(1088-1099) gesandt, von Anhängern <strong>de</strong>s Gegenpapstes Wibert von Ravenna (1084-1100)<br />
<strong>in</strong> Rom gefangen genommen wur<strong>de</strong>; Gebhard von Hirsau (1091-1105), <strong>de</strong>r Nachfolger Wilhelms,<br />
Siegfried von Schaffhausen (1082-1096), <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m neuen Kloster Reliquien von Petri<br />
Ketten schenkte, Theo<strong>de</strong>rich von Petershausen (1086-1116), Konrad von Ettenheimmünster<br />
(v.1093-ca.1116), Otto I. von St. Blasien (1086-1108) <strong>und</strong> Theoger von St. Georgen (1088-<br />
1119). E<strong>in</strong>e erneute Weihe <strong>de</strong>r Klosterkirche von St. Peter am 30. September 1113, also<br />
über 20 Jahre später, fand unter Führung <strong>de</strong>s Konsekrators Bischof Wido von Chur (1095-<br />
1122) die Repräsentanten fast <strong>de</strong>rselben <strong>Klöster</strong> anwesend: Theoger von St. Georgen, Eppo<br />
von St. Peter (1108-1132), Bruno von Hirsau (1105-1120), Rustenus von St. Blasien (1108-<br />
1125), Adalbert von Schaffhausen (1099-ca.1130) sowie Otto von Rhe<strong>in</strong>au <strong>und</strong> Eg<strong>in</strong>o von<br />
(St. Afra <strong>in</strong>) Augsburg (1109-1120). Auch bei <strong>de</strong>r zweiten Weihe wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Zusammenhalt<br />
<strong>de</strong>r Reformklöster <strong>und</strong> <strong>de</strong>r schwäbischen Reformpartei somit aufs Beste durch die Anwesenheit<br />
<strong>de</strong>r Äbte dokumentiert.<br />
<strong>Klöster</strong> <strong>und</strong> Heilige. Heilige waren/s<strong>in</strong>d Frauen o<strong>de</strong>r Männer, die <strong>in</strong> <strong>de</strong>r christlichen Religion<br />
nicht nur <strong>de</strong>s Mittelalters auf Gr<strong>und</strong> ihrer Verdienste (Martyrium, Bekennertum u.a.) allge-<br />
<strong>Michael</strong> Buhlmann, <strong>Klöster</strong> <strong>und</strong> <strong>Stifte</strong> <strong>in</strong> <strong>Ba<strong>de</strong>n</strong>-<strong>Württemberg</strong> 19