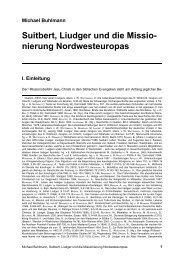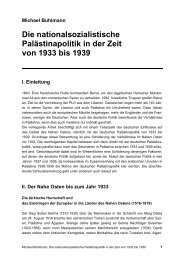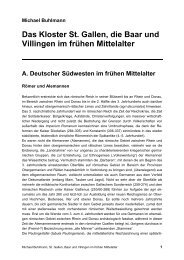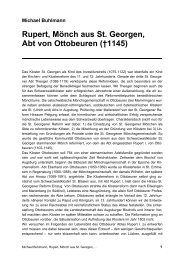Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Klöster und Stifte in Baden-Württemberg - Michael-buhlmann.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
mit Datum vom 8. März 1258 für Urspr<strong>in</strong>g ausstellte. In <strong>de</strong>r Folgezeit gewann Urspr<strong>in</strong>g –<br />
auch weil es sich immer mehr von se<strong>in</strong>en benedikt<strong>in</strong>isch-klösterlichen Gr<strong>und</strong>lagen entfernte<br />
– größeres Ansehen bei <strong>de</strong>n A<strong>de</strong>lsgeschlechtern <strong>de</strong>r Umgebung, die ihre nun mit Eigenbesitz<br />
ausgestatteten Töchter stan<strong>de</strong>sgemäß unterbr<strong>in</strong>gen konnten. St. Georgen konnte <strong>und</strong><br />
wollte dieser Entwicklung nicht entgegensteuern, zumal – so sche<strong>in</strong>t es – das Frauenkloster<br />
gegenüber <strong>de</strong>r Mönchsgeme<strong>in</strong>schaft im Schwarzwald an Selbstständigkeit gewann. E<strong>in</strong> eigenes<br />
Siegel (1258/75), die kaum feststellbare Beteiligung <strong>de</strong>s St. Georgener Abts an Urspr<strong>in</strong>ger<br />
Güterkäufen <strong>und</strong> -verkäufen, e<strong>in</strong>e über weite Strecken fehlen<strong>de</strong> geistliche <strong>und</strong><br />
rechtliche Aufsicht über das Frauenkloster belegen dies, <strong>de</strong>r Festschreibung <strong>de</strong>r Rechte St.<br />
Georgens <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Urk<strong>und</strong>e vom 14. April 1328 zum Trotz. Auch an <strong>de</strong>r Bursfel<strong>de</strong>r Klosterreform<br />
für <strong>de</strong>n zusammengeschmolzenen Urspr<strong>in</strong>ger Frauenkonvent (1475) war St. Georgen,<br />
das selbst nicht reformiert wur<strong>de</strong>, nur <strong>in</strong>direkt beteiligt. Das Kloster Urspr<strong>in</strong>g blieb aber St.<br />
Georgen weiter unterstellt. Daran än<strong>de</strong>rte ebenfalls die Reformation nichts (1536/66);<br />
Urspr<strong>in</strong>g befand sich seit 1566 unter <strong>de</strong>r Leitung <strong>de</strong>s katholischen Abtes <strong>de</strong>s Georgsklosters,<br />
<strong>de</strong>r <strong>in</strong> Vill<strong>in</strong>gen residierte. Erst Streitigkeiten im Urspr<strong>in</strong>ger Konvent nach <strong>de</strong>r Wahl <strong>de</strong>r Äbtiss<strong>in</strong><br />
Maria Ab<strong>und</strong>antia von Barille (1797-1806/15) führten 1802 dazu, dass St. Georgen auf<br />
se<strong>in</strong>e Rechte <strong>in</strong> Urspr<strong>in</strong>g verzichtete. Das Benedikt<strong>in</strong>er<strong>in</strong>nenkloster ist dann 1806 säkularisiert<br />
wor<strong>de</strong>n.<br />
Vill<strong>in</strong>gen (Stadt)<br />
Der Ort Vill<strong>in</strong>gen wird erstmals 817 <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Urk<strong>und</strong>e Kaiser Ludwigs <strong>de</strong>s Frommen (814-840)<br />
für das Kloster St. Gallen erwähnt. Fast zweih<strong>und</strong>ert Jahre später verlieh Kaiser Otto III.<br />
(983-1002) <strong>de</strong>m Zähr<strong>in</strong>gergrafen Berthold (991/96-1024) am 29. März 999 Markt-, Münz-<br />
<strong>und</strong> Zollrecht für Vill<strong>in</strong>gen. Im 12. Jahrh<strong>und</strong>ert entwickelte sich neben Alt-Vill<strong>in</strong>gen die „Zähr<strong>in</strong>gerstadt“,<br />
die nach <strong>de</strong>m Aussterben <strong>de</strong>s Herzogsgeschlecht (1218) an die Staufer kam,<br />
schließlich 1283 als erbliches Reichslehen an die Grafen von Fürstenberg. Für die Zeit <strong>de</strong>s<br />
späteren Mittelalters wird dann die Glie<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Stadt erkennbar. E<strong>in</strong> Kreuz zweier Haupt-<br />
als Marktstraßen bil<strong>de</strong>t das topografische Gerüst <strong>de</strong>s Ortes, e<strong>in</strong>es Stadtovals, umrahmt von<br />
e<strong>in</strong>er Stadtmauer aus <strong>de</strong>m 13. Jahrh<strong>und</strong>ert. Das be<strong>de</strong>utendste mittelalterliche Bau<strong>de</strong>nkmal<br />
ist das Vill<strong>in</strong>ger Münster, e<strong>in</strong>e spätromanische dreischiffige Basilika, die im 13. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
entstand <strong>und</strong> nach <strong>de</strong>m großen Stadtbrand von 1271 bis zum 16. Jahrh<strong>und</strong>ert wie<strong>de</strong>rerrichtet<br />
wur<strong>de</strong>. Wi<strong>de</strong>rstän<strong>de</strong> gegen <strong>de</strong>n fürstenbergischen Grafen als Stadtherrn führten u.a. 1326<br />
dazu, dass sich Vill<strong>in</strong>gen <strong>de</strong>r österreichischen Herrschaft unterstellte. Vill<strong>in</strong>ger Bürger waren<br />
an <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rschlagung <strong>de</strong>s Bauernaufstands (1525) beteiligt, <strong>de</strong>r Ort nahm nach <strong>de</strong>r Reformationszeit<br />
<strong>de</strong>n katholischen Mönchskonvent <strong>de</strong>s Klosters St. Georgen auf. Drei schwedisch-württembergische<br />
Belagerungen während <strong>de</strong>s Dreißigjährigen Krieges scheiterten.<br />
Französische Angriffe auf Vill<strong>in</strong>gen prägten das ausgehen<strong>de</strong> 17. <strong>und</strong> die 1. Hälfte <strong>de</strong>s 18.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts. 1805 wur<strong>de</strong> Vill<strong>in</strong>gen württembergisch, 1806 badisch.<br />
Zur kirchlichen Topografie gehörten neben <strong>de</strong>m Münster das 1288 gestiftete Spital, die Franziskanerkirche<br />
(1268), die Kirche <strong>de</strong>r Johanniter (1257), das St. Klara-Kloster am Bickentor<br />
(Anfang <strong>de</strong>s 14. Jahrh<strong>und</strong>erts). Dem entsprach es, dass gera<strong>de</strong> im 13. Jahrh<strong>und</strong>ert <strong>in</strong> Vill<strong>in</strong>gen<br />
Beg<strong>in</strong>en <strong>und</strong> Schwesternsammlungen <strong>in</strong> Ersche<strong>in</strong>ung traten (Zisterzienser<strong>in</strong>nen vom<br />
„neuen Haus“ 1238, Vettersammlung 1255, Dom<strong>in</strong>ikaner<strong>in</strong>nen 1259, Waldhauser Sammlung<br />
1274) <strong>und</strong> sich 1308 das Klarissenkloster am Bickentor ausformte. Die Vill<strong>in</strong>ger Johanniter-<br />
<strong>Michael</strong> Buhlmann, <strong>Klöster</strong> <strong>und</strong> <strong>Stifte</strong> <strong>in</strong> <strong>Ba<strong>de</strong>n</strong>-<strong>Württemberg</strong> 88