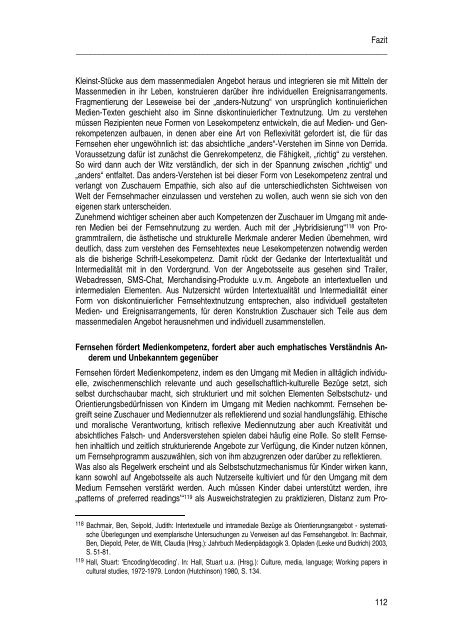Fördert Fernsehen Medienkompetenz? - KOBRA - Universität Kassel
Fördert Fernsehen Medienkompetenz? - KOBRA - Universität Kassel
Fördert Fernsehen Medienkompetenz? - KOBRA - Universität Kassel
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Fazit<br />
___________________________________________________________________________<br />
Kleinst-Stücke aus dem massenmedialen Angebot heraus und integrieren sie mit Mitteln der<br />
Massenmedien in ihr Leben, konstruieren darüber ihre individuellen Ereignisarrangements.<br />
Fragmentierung der Leseweise bei der „anders-Nutzung“ von ursprünglich kontinuierlichen<br />
Medien-Texten geschieht also im Sinne diskontinuierlicher Textnutzung. Um zu verstehen<br />
müssen Rezipienten neue Formen von Lesekompetenz entwickeln, die auf Medien- und Genrekompetenzen<br />
aufbauen, in denen aber eine Art von Reflexivität gefordert ist, die für das<br />
<strong>Fernsehen</strong> eher ungewöhnlich ist: das absichtliche „anders“-Verstehen im Sinne von Derrida.<br />
Voraussetzung dafür ist zunächst die Genrekompetenz, die Fähigkeit, „richtig“ zu verstehen.<br />
So wird dann auch der Witz verständlich, der sich in der Spannung zwischen „richtig“ und<br />
„anders“ entfaltet. Das anders-Verstehen ist bei dieser Form von Lesekompetenz zentral und<br />
verlangt von Zuschauern Empathie, sich also auf die unterschiedlichsten Sichtweisen von<br />
Welt der Fernsehmacher einzulassen und verstehen zu wollen, auch wenn sie sich von den<br />
eigenen stark unterscheiden.<br />
Zunehmend wichtiger scheinen aber auch Kompetenzen der Zuschauer im Umgang mit anderen<br />
Medien bei der Fernsehnutzung zu werden. Auch mit der „Hybridisierung“ 118 von Programmtrailern,<br />
die ästhetische und strukturelle Merkmale anderer Medien übernehmen, wird<br />
deutlich, dass zum verstehen des Fernsehtextes neue Lesekompetenzen notwendig werden<br />
als die bisherige Schrift-Lesekompetenz. Damit rückt der Gedanke der Intertextualität und<br />
Intermedialität mit in den Vordergrund. Von der Angebotsseite aus gesehen sind Trailer,<br />
Webadressen, SMS-Chat, Merchandising-Produkte u.v.m. Angebote an intertextuellen und<br />
intermedialen Elementen. Aus Nutzersicht würden Intertextualität und Intermedialität einer<br />
Form von diskontinuierlicher Fernsehtextnutzung entsprechen, also individuell gestalteten<br />
Medien- und Ereignisarrangements, für deren Konstruktion Zuschauer sich Teile aus dem<br />
massenmedialen Angebot herausnehmen und individuell zusammenstellen.<br />
<strong>Fernsehen</strong> fördert <strong>Medienkompetenz</strong>, fordert aber auch emphatisches Verständnis Anderem<br />
und Unbekanntem gegenüber<br />
<strong>Fernsehen</strong> fördert <strong>Medienkompetenz</strong>, indem es den Umgang mit Medien in alltäglich individuelle,<br />
zwischenmenschlich relevante und auch gesellschaftlich-kulturelle Bezüge setzt, sich<br />
selbst durchschaubar macht, sich strukturiert und mit solchen Elementen Selbstschutz- und<br />
Orientierungsbedürfnissen von Kindern im Umgang mit Medien nachkommt. <strong>Fernsehen</strong> begreift<br />
seine Zuschauer und Mediennutzer als reflektierend und sozial handlungsfähig. Ethische<br />
und moralische Verantwortung, kritisch reflexive Mediennutzung aber auch Kreativität und<br />
absichtliches Falsch- und Andersverstehen spielen dabei häufig eine Rolle. So stellt <strong>Fernsehen</strong><br />
inhaltlich und zeitlich strukturierende Angebote zur Verfügung, die Kinder nutzen können,<br />
um Fernsehprogramm auszuwählen, sich von ihm abzugrenzen oder darüber zu reflektieren.<br />
Was also als Regelwerk erscheint und als Selbstschutzmechanismus für Kinder wirken kann,<br />
kann sowohl auf Angebotsseite als auch Nutzerseite kultiviert und für den Umgang mit dem<br />
Medium <strong>Fernsehen</strong> verstärkt werden. Auch müssen Kinder dabei unterstützt werden, ihre<br />
„patterns of ‚preferred readings’“ 119 als Ausweichstrategien zu praktizieren, Distanz zum Pro-<br />
118 Bachmair, Ben, Seipold, Judith: Intertextuelle und intramediale Bezüge als Orientierungsangebot - systematische<br />
Überlegungen und exemplarische Untersuchungen zu Verweisen auf das Fernsehangebot. In: Bachmair,<br />
Ben, Diepold, Peter, de Witt, Claudia (Hrsg.): Jahrbuch Medienpädagogik 3. Opladen (Leske und Budrich) 2003,<br />
S. 51-81.<br />
119 Hall, Stuart: ‘Encoding/decoding’. In: Hall, Stuart u.a. (Hrsg.): Culture, media, language; Working papers in<br />
cultural studies, 1972-1979. London (Hutchinson) 1980, S. 134.<br />
112