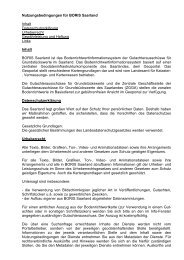Begründung und Erläuterungsbericht - Geoportal Saarland
Begründung und Erläuterungsbericht - Geoportal Saarland
Begründung und Erläuterungsbericht - Geoportal Saarland
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Landschaftsprogramm <strong>Saarland</strong><br />
Waldwirtschaft<br />
ohnehin bodensauren Böden auf Quarzit hat auf Gr<strong>und</strong> der geringen Pufferkapazität bereits auf großen Flächen<br />
eine Destabilisierung der Böden stattgef<strong>und</strong>en. R<strong>und</strong> die Hälfte der im <strong>Saarland</strong> im Zuge einer Bodenzustandserfassung<br />
untersuchten Waldböden liegt im oberen Bereich im Aluminium- bzw. Eisen-Aluminium-<br />
Pufferbereich mit pH-Werten unter 4,2.<br />
Auf bereits stark versauerte Böden soll daher eine Kompensation des Säureeintrags durch Oberflächenkalkung<br />
erfolgen. Kompensationskalkungen zielen darauf ab, die über die Deposition (Niederschläge) eingetragenen<br />
anthropogen bedingten Säuremengen in den obersten Bodenschichten über einen gewissen Zeitabschnitt<br />
zu neutralisieren, den Bodenzustand dadurch zu stabilisieren <strong>und</strong> gegebenenfalls auch zu verbessern.<br />
Kompensationskalkungen sind derzeit die einzige forstliche Möglichkeit, besonders gefährdeten Waldstandorten<br />
unmittelbar neues Säurepufferungsvermögen zu Verfügung zu stellen. Flankierend dazu sollten im<br />
Wald alle Möglichkeiten zur Stabilisierung der Waldstandorte durch waldbauliche Maßnahmen <strong>und</strong> entsprechende<br />
Nutzungskonzepte (Vermeidung des Anbaus standortfremder Nadelbäume bzw. die Überführung<br />
bestehender Nadelbaumbestände) ausgeschöpft werden.<br />
Durch die Kalkungen soll keine Nivellierung der von Natur aus – aufgr<strong>und</strong> unterschiedlicher geologischer<br />
Substrate <strong>und</strong> Bodengenese – verschiedenen Waldstandorte erfolgen.<br />
Als kurzfristiges Ziel soll die Bodenschutzkalkung die in den nächsten Jahren zu erwartenden Einträge anorganischer<br />
Säuren in die Waldökosysteme durch Kalkzersetzung abpuffern. Langfristig sollen anthropogen<br />
bedingte Säureeinträge gestoppt werden, damit sich die Säuren-Basen-Verhältnisse im Mineralboden einem<br />
natürlichen Niveau angleichen.<br />
Nach einer überschlägigen Einschätzung sind im <strong>Saarland</strong> ca. 20.000 ha Waldfläche im Staatswald (ohne<br />
Karbon) prioritär kalkungsnotwendig. Darunter fallen von Natur aus schwach basenversorgte, calcium- <strong>und</strong><br />
magnesiumarme, stark versauerte <strong>und</strong> durch atmogene Säureeinträge besonders gefährdete Standorte.<br />
Schwerpunkträume notwendiger Kompensationskalkungen liegen damit zunächst im Buntsandsteinbereich,<br />
im Karbon, im Bereich nährstoffarmer Böden des Devon sowie im Bereich saurer Ergussgesteine <strong>und</strong> ärmerer<br />
Verwitterungsdecken des Rotliegenden.<br />
Die genaue Festlegung von Kalkungsflächen erfolgt einzelfallbezogen im Einvernehmen mit der Wasserwirtschaft<br />
<strong>und</strong> dem Naturschutz. In diesem Zusammenhang werden auch von Kalkungen auszusparende Flächen<br />
sowie zu diesen Flächen einzuhaltende Pufferbereiche verortet.<br />
Kalkungsmaßnahmen werden durch repräsentative Bodenuntersuchungen vorbereitet <strong>und</strong> unterstützt, zur<br />
Wirkungskontrolle sind entsprechende Nullflächen auszuweisen.<br />
Die Entbasung der Waldböden durch Schadstoffimmissionen ist ein überregionales Problem. Eine nachhaltige<br />
Bodenentwicklung kann letztlich nur über die Bekämpfung der Ursachen der Bodenversauerung, durch<br />
die konsequente Reduktion der Emissionen, erreicht werden.<br />
9.5.2 "Waldsterben"<br />
Im Zusammenhang mit den Stoffeinträgen in Waldökosysteme steht das "Waldsterben". Auf die Frage nach<br />
den Kausalketten der "neuartigen Waldschäden" gibt es bis heute keine letztgültige Antwort. Es wird davon<br />
ausgegangen, dass die synergetischen Wechselwirkungen der anthropogenen Stoffeinträge mit dem komplexen<br />
Ökosystem Wald die Schäden hervorrufen – ohne diese im Einzelnen zu kennen.<br />
Nach Erreichen eines Höchststandes im Jahre 2006 war seit 2007 ein Rückgang zu verzeichnen. Im Jahre<br />
2008 zeigen 82 Prozent der Waldbäume Schadsymptome. Die starke Zunahme der Waldschadsymptome<br />
bis zum Jahre 2006 ist Folge des trocken-heißen Sommers 2003, der zusätzlich zu den Belastungen durch<br />
versauerte Waldböden mit ins Ungleichgewicht geratenen Nährstoffkreisläufen <strong>und</strong> vorgeschädigten Wurzelsystemen<br />
stark die Vitalität beeinträchtigte.<br />
9.5.3 Gr<strong>und</strong>wasserabsenkung<br />
Die Veränderung der Standortbedingungen durch eine Absenkung des Gr<strong>und</strong>wasserspiegels kann nicht nur<br />
zu Standortverlusten für feuchteabhängige Waldgesellschaften führen, sondern auch eine Destabilisierung<br />
der Waldbestände durch Trockenstress bewirken, insbesondere dann, wenn diese durch anthropogene Stoffeinträge<br />
bereits stark geschädigt sind.<br />
113