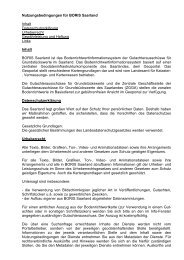Begründung und Erläuterungsbericht - Geoportal Saarland
Begründung und Erläuterungsbericht - Geoportal Saarland
Begründung und Erläuterungsbericht - Geoportal Saarland
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Landschaftsprogramm <strong>Saarland</strong><br />
Gewässer <strong>und</strong> Auen<br />
Untertägiger Bergbau, umfangreiche Gr<strong>und</strong>wasserförderung im Lauterbachtal <strong>und</strong> der 100m tiefe Sandabbau<br />
an der deutsch-französischen Grenze bei Merlebach führten zu einer deutlichen Absenkung des<br />
Gr<strong>und</strong>wasserstandes im einst wasserreichen Warndt (Buntsandstein), so dass dort die meisten Bäche <strong>und</strong><br />
Quellen keine natürliche Wasserführung mehr besitzen. Die heute noch wasserführenden Bäche verdanken<br />
ihr Wasser ausschließlich der Einleitung von Abwässern. Um zu verhindern, dass die abwasserbelasteten<br />
Bäche im Untergr<strong>und</strong> versickern, wurden sie weitgehend mit Betonhalbschalen ausgebaut. Aber auch in<br />
anderen Teilen des Landes hat der Bergbau Einfluss auf das Gr<strong>und</strong>wasser, den Landschaftswasserhaushalt<br />
<strong>und</strong> die Wasserführung von Quellbächen.<br />
Eine Sonderstellung nimmt die Saar ein: sie wurde traditionell als Verkehrs- <strong>und</strong> Handelsweg genutzt. Schon<br />
im Mittelalter transportierten kleine Schiffe ihre Waren flussabwärts über Saar, Mosel <strong>und</strong> Rhein. Um gegen<br />
die Strömung anzukommen, wurden Leinpfade angelegt, auf denen zunächst Pferde <strong>und</strong> später Traktoren<br />
die Schiffe flussaufwärts zogen. Umfangreiche „Korrekturen“ am Flusslauf seit dem 17. Jh. bis hin zum Ausbau<br />
zur Großschifffahrtsstraße „passten“ die Saar als Verkehrsweg in den Verdichtungsraum ein.<br />
Mosel <strong>und</strong> Saar fallen als B<strong>und</strong>eswasserstraßen in die Kategorie der Gewässer I. Ordnung. Blies, Schwarzbach,<br />
Prims, Nied, Rossel, Bist, die Theel zum Teil <strong>und</strong> der Saaraltarm St. Arnual zählen zu den Gewässern<br />
II. Ordnung. Während die Gewässer I. Ordnung in die Unterhaltungspflicht des B<strong>und</strong>es <strong>und</strong> die II. Ordnung<br />
in die Unterhaltungspflicht des Landes fallen, liegt die Unterhaltungslast für die Gewässer III. Ordnung meist<br />
bei den Kommunen. Nur in wenigen Fällen sind heute noch Wasser- <strong>und</strong> Bodenverbände aktiv (z.B. Einöd).<br />
Daneben gibt es noch eine Vielzahl kleiner, namenloser Gewässer, die nur periodisch Wasser führen. Informationen<br />
zum Ausbauzustand liegen flächendeckend vor. Zum Gewässerzustand (Gewässergüte) liegen<br />
Informationen nur für einen Teil der Fließgewässer vor.<br />
Die größeren Fließgewässer schufen auf Gr<strong>und</strong> ihrer Dynamik <strong>und</strong> Wasserführung in den geologisch weicheren<br />
Schichten ausgedehnte Überschwemmungsbereiche. Kleinere Bäche konnten bei Talgefällen bis<br />
etwa 1,5 % ebenfalls beachtliche Aueflächen entwickeln, wenn sie morphologisch weichere Schichten querten.<br />
Die wichtigsten Fließgewässersysteme des <strong>Saarland</strong>es sind die Systeme der Prims, Blies, Theel/Ill,<br />
Nied, Bist <strong>und</strong> Rossel, die letztlich Teile des Saarsystems sind. Die Mosel besitzt im <strong>Saarland</strong> keinen nennenswerten<br />
Zufluss. Die Saar erhält zahlreiche direkte Zuflüsse (Sulzbach, Rohrbach, Fischbach, Köllerbach,<br />
Bommersbach) aus dem Verdichtungsraum, die durch behandeltes bzw. unzureichend behandeltes<br />
Abwasser belastet sind <strong>und</strong> demzufolge auch den Niedrigwasserabfluss prägen. Diese Fließgewässer sind<br />
oft sehr stark überformt. Auch Rossel <strong>und</strong> Bist weisen ein stark durch den Bergbau geprägtes Einzugsgebiet<br />
(überwiegend jenseits der französischen Grenze) auf, wobei die Zuflüsse auf deutscher Seite kaum mehr ins<br />
Gewicht fallen. Die ehemals extreme Belastung der Rossel durch Kohlenschlamm hat in den letzten Jahrzehnten<br />
drastisch abgenommen <strong>und</strong> findet seit der Schließung der Kohlegruben in Lothringen <strong>und</strong> im<br />
Warndt praktisch nicht mehr statt. Die Bist, teilweise begradigt, durchquert unterhalb Überherrn eine geologische<br />
Senke, die eine starke Aufweitung ihrer Aue erlaubt hat <strong>und</strong> fast unbesiedelt geblieben ist. Die Nied<br />
besitzt ein weitgehend ländliches, wenig versiegeltes Einzugsgebiet mit zahlreichen naturnahen Zuflüssen,<br />
die allerdings teilweise erhebliche Belastungen durch kommunale <strong>und</strong> diffuse Einleiter aufweisen. Die Nied<br />
weist in Bezug auf Gewässerstruktur <strong>und</strong> Gewässerzustand (Gewässergüte) einen verhältnismäßig guten<br />
Zustand auf. Das Einzugsgebiet der aus dem Hochwald kommenden Prims umfasst einen Großteil des nördlichen<br />
<strong>und</strong> mittleren <strong>Saarland</strong>es mit am Hunsrückrand walddominierten, nach Süden hin landwirtschaftsdominierten<br />
Nutzungen <strong>und</strong> geringer Siedlungsdichte. Trotz der Aufstauung durch die Nonnweiler Talsperre<br />
weist die Prims die höchste Fließgeschwindigkeit <strong>und</strong> Dynamik der größeren saarländischen Fließgewässer<br />
auf. Einem weitgehend unbefestigten, naturnahen Ober- <strong>und</strong> Mittellauf mit extensiv genutzten Auen steht ein<br />
teilweise sehr eingeengter Unterlauf gegenüber, der in einer - infolge Auskiesung <strong>und</strong> Industrialisierung -<br />
stark überformten Aue verläuft. Die im östlichen <strong>Saarland</strong> fließende Blies erhält bereits im Oberlauf bei Niedrigwasserabfluss<br />
Wasser aus der Talsperre Nonnweiler. Der Oberlauf wird durch die Einleitungen unzureichend<br />
behandelter kommunaler Abwässer <strong>und</strong> aus diffusen Nährstoffquellen belastet. Ab St. Wendel<br />
wurden mehrere Abschnitte der Blies bis unterhalb Neunkirchen technisch ausgebaut. Mit Erreichen des<br />
Buntsandsteingebietes beginnt die Blies in einem breiten Sohlental zu mäandern <strong>und</strong> quert in einem überwiegend<br />
naturnahen Gewässerbett das Muschelkalkgebiet. Das Einzugsgebiet der Blies reicht von landwirtschaftlich<br />
geprägten Bereichen im Oberlauf über dicht besiedelte Bereiche im Raum Neunkirchen <strong>und</strong> Homburg<br />
bis zum wiederum landwirtschaftlich geprägten Bliesgau. Diese Fließgewässer <strong>und</strong> ihre abwechslungsreichen<br />
Talräume prägen das Erscheinungsbild <strong>und</strong> das „Image“ der jeweiligen Landschaftsräume.<br />
Auen stehen in enger Beziehung zum Fließgewässer. Wie kaum ein zweiter Lebensraum werden sie durch<br />
dynamische Prozesse geprägt. Die auftretenden Überflutungen <strong>und</strong> der hohe Gr<strong>und</strong>wasserstand schaffen<br />
Voraussetzungen, mit denen nur bestimmte Arten zurechtkommen. Sie besitzen deshalb ein Arteninventar,<br />
das sich von anderen Bereichen deutlich abhebt. Als Sonderstandorte spielen sie eine besondere Rolle im<br />
Naturhaushalt <strong>und</strong> in der Kulturlandschaft.<br />
36