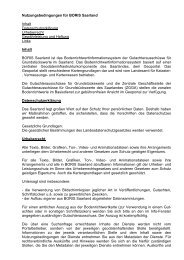Begründung und Erläuterungsbericht - Geoportal Saarland
Begründung und Erläuterungsbericht - Geoportal Saarland
Begründung und Erläuterungsbericht - Geoportal Saarland
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Landschaftsprogramm <strong>Saarland</strong><br />
Erhaltung der Kulturlandschaft<br />
7.3 Die Kulturlandschaftsräume<br />
Die aktuelle Raumstruktur ist das Ergebnis eines Entwicklungsprozesses,<br />
dessen Spuren heute noch in der<br />
Landschaft sichtbar sind. Sie werden durch Interpretation<br />
der ökologischen Voraussetzungen <strong>und</strong> der sozioökonomischen<br />
Kontexte lesbar. Die Abbildung zeigt<br />
die Gr<strong>und</strong>züge der raumprägenden Prozesse in den<br />
jeweiligen Entwicklungsphasen. Kulturlandschaftsräume<br />
sind somit Einheiten, die sich auf Gr<strong>und</strong> ihrer eigenständigen<br />
historischen <strong>und</strong> gegenwärtigen Entwicklung<br />
deutlich gegen andere Räume abgrenzen. Im<br />
Landschaftsprogramm werden in einem ersten Schritt<br />
die Großräume benannt; eine Differenzierung in Untereinheiten<br />
steht noch aus. Zentrale Gr<strong>und</strong>lage bildet<br />
die strukturräumliche Gliederung des gültigen LEP<br />
Siedlung. Er unterscheidet den Ordnungsraum mit<br />
Kern- <strong>und</strong> Randzone des Verdichtungsraumes sowie<br />
den ländlichen Raum.<br />
Entwicklung von Gesellschaft <strong>und</strong> Raum<br />
natürliche Ökosysteme<br />
kulturelle Evolution<br />
anthropogene Ökosysteme<br />
agrarische Revolution<br />
Agrarsysteme<br />
urbane Revolution<br />
Siedlungssysteme<br />
Agrargesellschaft<br />
Stadt-Landschaft des Ordnungsraumes<br />
(„Stadtregion“)<br />
Die Stadtregion umfasst ca. 40 % der Gesamtfläche<br />
des <strong>Saarland</strong>es; hier leben 780.000 der ca. 1,05 Millionen<br />
Einwohner. Dieser hoch verdichtete Raum wird<br />
heute maßgeblich von den Agglomerationen im Umfeld<br />
der Industriestandorte <strong>und</strong> der Siedlungsachsen bestimmt.<br />
Die so entstandene Stadt-Landschaft besitzt<br />
eine spezifische Topografie. Die (alt)industriellen <strong>und</strong><br />
Bergbaufolgelandschaften umfassen einen engmaschigen<br />
Verflechtungsbereich, der sich als Band zwischen Dillingen, Saarbrücken, Neunkirchen <strong>und</strong> Homburg<br />
erstreckt, <strong>und</strong> seine Fortsetzung in Frankreich im ostlothringischen Kohlenbecken findet. Ein besonderes<br />
Merkmal der Stadt-Landschaft an der Saar sind die ausgedehnten Waldgebiete mit dem naturnahen<br />
Saarkohlenwald im Zentrum. Sie durchziehen den Ordnungsraum als eine sich von Südwesten (Warndt)<br />
nach Nordosten (Homburger Wald) erstreckende „Waldachse“. In den Randzonen des Verdichtungsraumes<br />
nimmt die Bevölkerungsdichte deutlich ab. Dennoch zählen die suburbanisierten Wald- <strong>und</strong> Agrarlandschaften<br />
in diesem Bereich zu den stark zersiedelten Räumen.<br />
Die Stadtlandschaft des Ordnungsraumes gliedert sich in:<br />
<br />
<br />
<br />
(Alt)Industrielle Stadtlandschaften <strong>und</strong> Bergbaufolgelandschaften,<br />
Suburbanisierte Waldlandschaften <strong>und</strong><br />
Suburbanisierte Agrarlandschaften.<br />
Agrarlandschaften<br />
industrielle Revolution<br />
industriell-technische<br />
Siedlungssysteme<br />
technologische Revolution<br />
telematisch-technologische<br />
Siedlungssysteme<br />
Industriegesellschaft<br />
Informationsgesellschaft<br />
An den Ordnungsraum schließen sich die ländlichen Gebiete der Gaulandschaften im Westen bzw. Südosten<br />
sowie des Hügellands im mittleren <strong>und</strong> nördlichen <strong>Saarland</strong> an. Diese von der Landwirtschaft geprägten<br />
Räume besitzen einen eigenständigen Charakter <strong>und</strong> ein typisches Landschaftsbild, die in Abhängigkeit von<br />
der Geländemorphologie <strong>und</strong> der Intensität agrarischer Nutzungen variieren. Die Landwirtschaft gehört in<br />
einigen Siedlungen noch zum dörflichen Leben, vielerorts wurden die Betriebe jedoch abseits der Siedlungen<br />
mitten in die Nutzflächen ausgesiedelt. Eine Zersiedelung der Landschaft wie in den suburbanisierten<br />
Räumen hat jedoch nicht stattgef<strong>und</strong>en. Während in den landwirtschaftlichen Schwerpunkträumen die Agrarnutzung<br />
auch künftig das Landschaftsbild prägen wird, besteht generell die Tendenz zur Aufgabe nicht<br />
optimal nutzbarer Agrarstandorte wie Hangbereiche, Feuchtstandorte <strong>und</strong> kleinschlägige Nutzungsmosaike.<br />
Auf den Gunststandorten versucht die Landwirtschaft Schlaggrößen <strong>und</strong> Nutzungseinheiten zu vergrößern.<br />
In den Gaulandschaften findet der Konzentrationsprozess insbesondere auf den Hochflächen <strong>und</strong> Flachhängen<br />
statt, im Hügelland in Abhängigkeit von der Bodengunst auf allen nicht zu hängigen oder nassen Standorten.<br />
Die Agrarlandschaften gliedern sich in:<br />
80