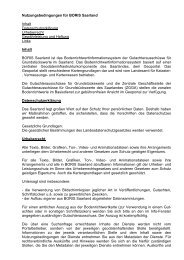Begründung und Erläuterungsbericht - Geoportal Saarland
Begründung und Erläuterungsbericht - Geoportal Saarland
Begründung und Erläuterungsbericht - Geoportal Saarland
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Landschaftsprogramm <strong>Saarland</strong><br />
Waldwirtschaft<br />
mehr statt, sodass das Wegesystem primär auf die ökopädagogischen Anforderungen ausgerichtet werden<br />
kann. Ein Rückbau von Artefakten, Infrastruktur <strong>und</strong> Wegen im Wald ist Voraussetzung für ein Gelingen des<br />
Wildnis-Konzeptes.<br />
Die Scheune Neuhaus als das „Zentrum für Waldkultur“ dient in diesem Zusammenhang als Informationszentrum<br />
für den Urwald selbst, als Initialisierungsstätte für urwaldbezogene ökopädagogische Projekte sowie<br />
darüber hinaus als Kommunikations- <strong>und</strong> Tagungszentrum für wald- <strong>und</strong> umweltrelevante Thematiken.<br />
Als Naturerlebnisorte sind das Steinbachtal <strong>und</strong> das Netzbachtal im Saarkohlenwald mit ihren naturnahen<br />
Auen <strong>und</strong> Fließgewässern sowie der naturnahen Waldentwicklung prädestiniert. Auch kleinflächige geologische<br />
Phänomene wie der Stiefel bei Sengscheid oder der Aufschluss des Holzer Konglomerats westlich von<br />
Holz können als Naturerlebnisorte dienen, allerdings nur, wenn sie von Erholungsinfrastruktur <strong>und</strong> Möblierung<br />
weitgehend freigehalten werden. Naturerlebnisorte im Sinne des aufgezeigten Konzeptes als Zielorte<br />
für die Freizeit- <strong>und</strong> Erholungsnutzung sind auf der Ebene des kommunalen Landschaftsplans darzustellen,<br />
zu entwickeln <strong>und</strong> informell zu erschließen.<br />
Maßnahmenschwerpunkte:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Konsequente Umsetzung der naturnahen Waldwirtschaft,<br />
Überführung aller naturraumfremden Wälder in naturnahe Wälder (erste Prioriät: besondere Waldstandorte)<br />
(siehe Karte „Waldwirtschaft <strong>und</strong> Landwirtschaft“),<br />
Nutzungsextensivierung auf besonderen Waldstandorten bei naturnaher Bestockung,<br />
Alterungs- <strong>und</strong> Verfallsphase in einigen Althölzern zulassen („alte Wälder“),<br />
Konsequenter Verzicht auf umfangreiche Erholungsinfrastruktureinrichtungen <strong>und</strong> Rückbau von diesbezüglichen<br />
„Artefakten“ im Wald,<br />
Wegerückbau, Entsiegelung, Verringerung der Wegebreiten, Rückbau der Bachquerungen (Vergrößerung<br />
des Abflussquerschnittes) <strong>und</strong> von Quellfassungen in den Naturerlebnisgebieten (erste Priorität:<br />
NSG „Waldschutzgebiet Steinbachtal/Netzbachtal“),<br />
Landmarken zur Kennzeichnung der kulturhistorischen Relikte (z.B. Solitäre, Altholzinseln, seltene<br />
Baumarten der pnV),<br />
Erholungsinfrastruktur ausschließlich mit Holzkonstruktionen (z.B. Schutzhütten, Bänke) sowie<br />
Extensivierung der bestehenden Infrastruktur <strong>und</strong> Integration in das Naturnähe-Konzept (vor allem in<br />
den Wäldern um St. Ingbert, Kirkel <strong>und</strong> Homburg).<br />
9.8.2 „Bergbauachse“<br />
Innerhalb der Bergbauachse müssen eine Rekultivierung von Bergbau-Altstandorten sowie eine Restrukturierung<br />
der Freiraumsituation erfolgen. In diesem Zusammenhang spielt die Waldwirtschaft eine zentrale<br />
Rolle. Zahlreiche Bergbau-(Alt)Standorte wurden bereits oder werden in Zukunft an die Forstverwaltung<br />
zurückgegeben. Hieraus entsteht für die Waldwirtschaft eine Querschnittsaufgabe, da viele dieser Standorte<br />
als bedeutende Relikte der Industriekultur im Zentrum einer kohärenten Entwicklung der Stadt-Landschaften<br />
stehen. So ist die Waldwirtschaft derzeit aktiv über die Plattform des „Regionalparks Saar“ an der Umsetzung<br />
dieser Agenda beteiligt.<br />
Maßnahmenschwerpunkte:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Integration der Haldenstandorte in ein Gesamtkonzept (Halden als Landmarken) (siehe Karte „Erhaltung<br />
der Kulturlandschaft, Erholungsvorsorge <strong>und</strong> Freiraumentwicklung“), Erschließung durch Wegeanbindung,<br />
Inwertsetzung als Aussichtspunkt <strong>und</strong> kulturhistorische Relikte (unter Einbeziehung der bergbaulich<br />
geprägten Umgebung),<br />
Einbindung der Einzelstandorte in die Umgebung <strong>und</strong> Verbesserung der Erreichbarkeit,<br />
Berücksichtigung der Belange des Arten- <strong>und</strong> Biotopschutzes,<br />
Renaturierung <strong>und</strong> Sanierung der Auen (siehe Karte „Oberflächengewässer <strong>und</strong> Auen“),<br />
prioritäre Überführung aller standortfremden Waldbestände auf seltenen Waldstandorten in naturnahe<br />
Wälder sowie<br />
Überlassung von Pionierwäldern auf Halden <strong>und</strong> Schlammweihern an die Sukzession (siehe Karte<br />
„Waldwirtschaft <strong>und</strong> Landwirtschaft“).<br />
121