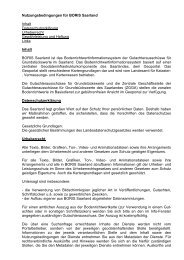Begründung und Erläuterungsbericht - Geoportal Saarland
Begründung und Erläuterungsbericht - Geoportal Saarland
Begründung und Erläuterungsbericht - Geoportal Saarland
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
10.1 Die Entwicklung der Landwirtschaft<br />
Landschaftsprogramm <strong>Saarland</strong><br />
Landwirtschaft<br />
Die Landwirtschaft in gallorömischer Zeit konzentrierte sich in erster Linie auf den Getreideanbau. Die weniger<br />
fruchtbaren Buntsandsteingebiete oder die versumpften Niederungen wurden als Weidegebiete für<br />
Schweine <strong>und</strong> Schafe sowie zum Anbau von Roggen <strong>und</strong> Hafer genutzt. Von der landwirtschaftlichen Nutzung<br />
in gallorömischer Zeit blieben wenige Ackerterrassen (Stufenraine) <strong>und</strong> Blockwälle erhalten.<br />
Die Bevölkerungszunahme <strong>und</strong> die Ansiedlungspolitik der Gr<strong>und</strong>herren führten im Mittelalter zu großen Rodungsperioden.<br />
Die zweite große Rodungsphase zwischen dem 11. <strong>und</strong> dem 14. Jahrh<strong>und</strong>ert legte die<br />
Gr<strong>und</strong>züge der Feld-Wald-Verteilung fest. Die parzellierten Gewannfluren erreichten im <strong>Saarland</strong> wie im<br />
übrigen südwestdeutschen Altsiedelbereich eine weite Verbreitung. Die Realerbteilung führte zu einer kleinteiligen<br />
Parzellierung der Flur. Eher selten – meist in Zusammenhang mit feudalem oder klerikalem Gr<strong>und</strong>besitz<br />
– blieben Blockfluren erhalten. Bis in die Gegenwart ist der landwirtschaftliche Gr<strong>und</strong>besitz stark zersplittert.<br />
Jedoch führten sowohl Flurbereinigungsverfahren als auch Besitzzusammenlegungen, bedingt<br />
durch den Strukturwandel, zu einer Vergrößerung der Schläge. Vielerorts sind nicht mehr die Besitzverhältnisse,<br />
sondern die Landschaftsstruktur schlagbegrenzend. Absolut gesehen sind die Schläge im <strong>Saarland</strong> im<br />
b<strong>und</strong>esweiten Vergleich nach wie vor als klein zu beurteilen <strong>und</strong> wirken damit als betriebswirtschaftliche<br />
Benachteiligung im Vergleich zu anderen B<strong>und</strong>esländern mit großen zusammenhängenden Agrarflächen.<br />
Das Agrarsystem war durch Stückelteilung <strong>und</strong> Gehöferschaften charakterisiert. Privates Gr<strong>und</strong>eigentum<br />
kam erst gegen Ende des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts auf. Landwirtschaftliche Gehöferschaften fanden sich jedoch bis<br />
ins 18. Jahrh<strong>und</strong>ert <strong>und</strong> leben heute im Bereich der Niederwaldwirtschaft noch fort. Die Bewirtschaftungsgrenzen<br />
zwischen Landwirtschaft <strong>und</strong> Wald waren zur damaligen Zeit fließend.<br />
Eine Hochphase erreichte diese Wirtschaftsform zu Beginn des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts, nachdem die Kriege <strong>und</strong><br />
Katastrophen des Mittelalters überw<strong>und</strong>en waren <strong>und</strong> die bäuerliche Landwirtschaft seit dem 17. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
wieder aufgebaut werden konnte. In dieser Zeit entstanden durch das bäuerliche Wirtschaften die Kulturlandschaften,<br />
die in ihren Gr<strong>und</strong>zügen bis in die heutige Zeit hinein erhalten geblieben sind. Die Flur wurde<br />
zunächst fast ausschließlich ackerbaulich genutzt. Die ackerbauliche Nutzung kann jedoch nicht mit heutigen<br />
Ackerflächen gleichgesetzt werden: Die mechanische, düngerextensive <strong>und</strong> kleinparzellierte Bearbeitung<br />
der Flächen führte zu einer kleinteiligen Gliederung der Flur mit differenzierten Saumgesellschaften<br />
sowie einer reichen Begleitfauna <strong>und</strong> -flora. Dennoch bleibt zu vermerken, dass landwirtschaftliche Nutzung<br />
in der Vergangenheit nicht nur (aus heutiger Sicht) positive Auswirkungen auf die Naturgüter zeigte. In Zeiten<br />
wirtschaftlicher Not wie beispielsweise nach dem Dreißigjährigen Krieg oder infolge starken Bevölkerungswachstums<br />
<strong>und</strong> herrschaftlicher Besitzverhältnisse wurden unter anderem Standorte in Steilhanglage<br />
gerodet <strong>und</strong> ackerbaulich genutzt sowie die Feld-Gras-Wirtschaft zugunsten der Dreifelderwirtschaft mit<br />
Schwarzbrache aufgegeben.<br />
Die Grünlandnutzung entwickelte sich als traditionelle Nutzung der Fluss- <strong>und</strong> Bachauen. Die Grünländer<br />
der nährstoffreichen Auenböden brachten lohnende Erträge, so dass bis Ende des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts nahezu<br />
alle Auen unter Grünlandnutzung standen.<br />
Die in der Mitte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts einsetzende Industrialisierung führte zu einem Strukturwandel in der<br />
Landwirtschaft, der bis heute im <strong>Saarland</strong> nicht abgeschlossen ist. Es entwickelte sich der Stand der Arbeiterbauern,<br />
die hauptberuflich in den Gruben oder aufkommenden Industriebetrieben arbeiteten, im Nebenerwerb<br />
mit ihren Familien die Flächen bewirtschafteten <strong>und</strong> Kleinviehhaltung ("Geißenbauern") betrieben.<br />
Auf Gr<strong>und</strong> der besseren Verdienstmöglichkeiten verdrängten Bergbau <strong>und</strong> Schwerindustrie die Landwirtschaft<br />
als bedeutenden Wirtschaftsfaktor. Allerdings behielt der bäuerliche Nebenerwerb seine Bedeutung<br />
bis in die 1950er Jahre. Bis heute wirtschaften die saarländischen Betriebe im b<strong>und</strong>esweiten Vergleich eher<br />
extensiv.<br />
Ein starker Rückgang der Nebenerwerbslandwirtschaft setzte in den 1950er Jahren ein; das Arbeiterbauerntum<br />
verlor bis Ende der 1960er Jahre an Bedeutung. Mit dem Wirtschaftsw<strong>und</strong>er wurden die Kleinviehhaltung<br />
<strong>und</strong> viele landwirtschaftliche Nutzflächen aufgegeben ("Sozialbrache"). Von 1950 bis 1960 wurde der<br />
Bestand an größeren Nutztieren in einigen Gebieten stark reduziert. Die Entwicklung führte zu einer Vergrünlandung<br />
<strong>und</strong> damit Extensivierung von Grenzertragsstandorten bis hin zur Bracheentwicklung in steileren<br />
Hangbereichen oder vernässten Mulden. Beispiele hierfür sind die verbrachten Hänge der Trochitenkalkstufe<br />
im Saar-Blies-Gau, auf denen heute teilweise bereits Vorwaldstadien stocken.<br />
In Bereichen mit hohem Sozialbracheanteil fanden auch die Neugründungen für Übersiedler <strong>und</strong> Aussiedlungen<br />
landwirtschaftlicher Betriebe in den 1960er <strong>und</strong> 70er Jahren statt. Die Gründe dieser Entwicklung<br />
lagen in den geringen Erweiterungsmöglichkeiten der Betriebe innerhalb der geschlossenen Ortslage <strong>und</strong><br />
126