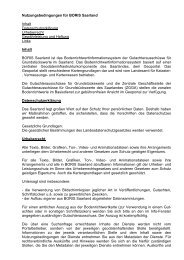Begründung und Erläuterungsbericht - Geoportal Saarland
Begründung und Erläuterungsbericht - Geoportal Saarland
Begründung und Erläuterungsbericht - Geoportal Saarland
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Landschaftsprogramm <strong>Saarland</strong><br />
Erhaltung der Kulturlandschaft<br />
Erfahrungen <strong>und</strong> Errungenschaften früherer Kulturen dauern an, sind präsent. Damit wird deutlich, dass<br />
Geschichte nicht einfach eine Folge von abgeschlossenen Geschehnissen ist, sondern dass neue Entwicklungen<br />
auf Vergangenem aufbauen <strong>und</strong> dieses erhalten oder verändern.<br />
Zusammenfassend ist festzuhalten:<br />
1. Landschaft hat Geschichte. Sie ist nicht nur Fläche sondern auch Prozess.<br />
2. Landschaftsgeschichte liefert bewusste <strong>und</strong> unbewusste Vorbilder (für Planung).<br />
3. Landschaftsgeschichte besitzt Präsenz. Sie setzt Rahmenbedingungen für Entwicklungsoptionen in der<br />
Zukunft.<br />
Von Kulturlandschaftsräumen bis zu kulturhistorischen Relikten...<br />
Das Thema Kulturlandschaft soll explizit unter dem Blickwinkel ihrer geschichtlichen Entwicklung behandelt<br />
werden. Gegenstand der Analyse ist also die Beschäftigung mit Kulturlandschaft in dem Maße, wie sie<br />
Landschaftsentwicklung <strong>und</strong> damit Entstehungs-, Persistenz- <strong>und</strong> Vergänglichkeitszusammenhänge erkennen<br />
lässt. Deshalb werden Kulturlandschaftseinheiten im Sinne einer siedlungsgenetischen Typologie herausgearbeitet.<br />
Der flächendeckende Ansatz der Kulturlandschaftsräume beschreibt die aktuelle Kulturlandschaft, in der sich<br />
die derzeitigen Nutzungen mit ihrer Eigengeschichtlichkeit niederschlagen. Es sind somit Räume gleichartiger<br />
<strong>und</strong> andauernder kultureller Entwicklungen. Im Vordergr<strong>und</strong> stehen hier die Entwicklungsdynamik dieser<br />
Räume <strong>und</strong> die Erfordernisse zur Gestaltung einer nachhaltigen Regionalentwicklung. Die im Landschaftsprogramm<br />
dargestellten Kulturlandschaftsräume sind eine erste Annäherung an eine Raumkategorisierung,<br />
die – in Anlehnung an das Konzept der naturräumlichen Gliederung – weitergehend differenziert werden<br />
muss. Kulturlandschaftsräume sind das Gestaltungsfeld der Landschaftspflege, aber auch des Städtebaus<br />
oder anderer raumwirksamer Aktivitäten <strong>und</strong> Nutzungen. Damit wird auch deutlich, dass ihre weitere Entwicklung<br />
eine ressortübergreifende, querschnittsorientierte Aufgabe darstellt.<br />
Demgegenüber beschäftigt sich der Kulturlandschaftsschutz im engeren oder „denkmalpflegerischen“ Sinne<br />
mit Gebieten, in denen die „historischen“ Nutzungen noch in besonderem Maße präsent sind. Diese als besonders<br />
wertvoll anzusehenden Kulturlandschaften befinden sich heute im Umbruch. Die Spuren tradierter<br />
Landnutzungen drohen als wichtige Zeugnisse des kulturellen Erbes der Region von aktuellen Prozessen<br />
überformt zu werden. In diesen besonders wertvollen Kulturlandschaften muss dieser Umbruch das kulturelle<br />
Erbe aufnehmen, bewerten <strong>und</strong> in die Zukunft fortschreiben.<br />
Kulturlandschaftsschutz ist dann die Beschäftigung mit kulturhistorischen Organisationsformen, gelesen an<br />
den Folgen ihres Wirkens, im weitesten Sinne des Nachwirkens. Dieses soll, wie in vielen Arbeiten realisiert,<br />
von verbliebenen Artefakten (als Aufhängern) ausgehen <strong>und</strong> sich in Erinnerung <strong>und</strong> Dokumentation niederschlagen,<br />
aber darüber hinaus das Wirkende erfassen, das sich in Gestalt von Erfahrungswissen niederschlägt,<br />
das überholt sein kann, aber die eigentliche Gr<strong>und</strong>lage des kulturellen Erbes darstellt. Die Verortung<br />
von besonders wertvollen Kulturlandschaften im Landschaftsprogramm (siehe Karte „Erhaltung der Kulturlandschaft,<br />
Erholungsvorsorge <strong>und</strong> Freiraumentwicklung“) erfolgt somit nach Maßgabe des historischen<br />
Schutzgr<strong>und</strong>es (im Sinne des Erfahrungswissens) – ausgehend von Repräsentativität <strong>und</strong> Anschaulichkeit<br />
(Visualität).<br />
Als artefaktische Elemente der Landschaft, Symbole oder in Form von Namen repräsentieren kulturhistorische<br />
Relikte vergangene (abgeschlossene) Entwicklungsprozesse. Sie stehen nicht mehr in einem ersichtlichen<br />
landschaftlichen Kontext, sondern als isolierte, museale Versatzstücke in Folgekontexten.<br />
Beispiele hierfür sind: Weinberg- <strong>und</strong> Ackerterrassen, Wölbäcker, Lesesteinmauern, Streuobstbestände,<br />
kulturhistorisch bedeutsame oder für bestimmte Landschaften charakteristische Steinbrüche, Stätten des<br />
historischen Bergbaues (z.B. Rötelpingen) <strong>und</strong> der überkommenen Industrie, Überreste wüstgefallener Siedlungen<br />
bzw. Gewerbeeinrichtungen oder ehemaliger Verteidigungsanlagen (Hunnenring, Westwall), Köhlerplätze,<br />
Reste der traditionellen Niederwaldwirtschaft, historische Verkehrstrassen, Alleen, Relikte historischer<br />
Friedhöfe <strong>und</strong> Parkanlagen, Mühlen mit Wehren, Teichen <strong>und</strong> Mühlgräben sowie Talböden mit Mähwiesen<br />
<strong>und</strong> Kopfweidenbeständen.<br />
Mit der Gliederung in Kulturlandschaftsräume, zu erhaltende besonders wertvolle Kulturlandschaften <strong>und</strong><br />
kulturhistorische Relikte (siehe Karte „Erhaltung der Kulturlandschaft, Erholungsvorsorge <strong>und</strong> Freiraumentwicklung“)<br />
ist ein Gr<strong>und</strong>stein gelegt, um Belangen des Kulturlandschaftsschutzes im methodischen Konzept<br />
der Landschaftsplanung Geltung zu verschaffen.<br />
79