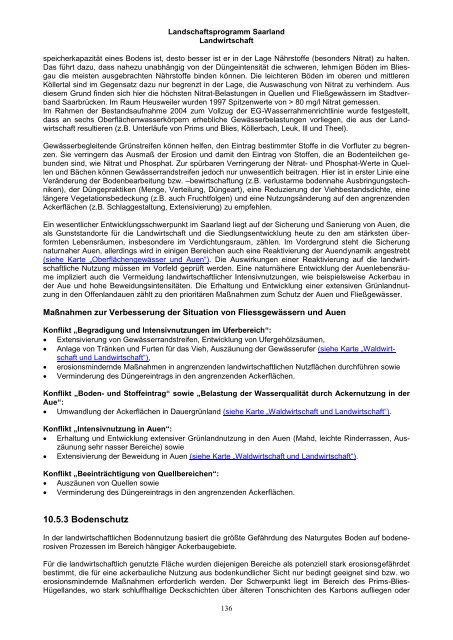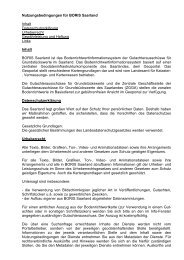Begründung und Erläuterungsbericht - Geoportal Saarland
Begründung und Erläuterungsbericht - Geoportal Saarland
Begründung und Erläuterungsbericht - Geoportal Saarland
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Landschaftsprogramm <strong>Saarland</strong><br />
Landwirtschaft<br />
speicherkapazität eines Bodens ist, desto besser ist er in der Lage Nährstoffe (besonders Nitrat) zu halten.<br />
Das führt dazu, dass nahezu unabhängig von der Düngeintensität die schweren, lehmigen Böden im Bliesgau<br />
die meisten ausgebrachten Nährstoffe binden können. Die leichteren Böden im oberen <strong>und</strong> mittleren<br />
Köllertal sind im Gegensatz dazu nur begrenzt in der Lage, die Auswaschung von Nitrat zu verhindern. Aus<br />
diesem Gr<strong>und</strong> finden sich hier die höchsten Nitrat-Belastungen in Quellen <strong>und</strong> Fließgewässern im Stadtverband<br />
Saarbrücken. Im Raum Heusweiler wurden 1997 Spitzenwerte von > 80 mg/l Nitrat gemessen.<br />
Im Rahmen der Bestandsaufnahme 2004 zum Vollzug der EG-Wasserrahmenrichtlinie wurde festgestellt,<br />
dass an sechs Oberflächenwasserkörpern erhebliche Gewässerbelastungen vorliegen, die aus der Landwirtschaft<br />
resultieren (z.B. Unterläufe von Prims <strong>und</strong> Blies, Köllerbach, Leuk, Ill <strong>und</strong> Theel).<br />
Gewässerbegleitende Grünstreifen können helfen, den Eintrag bestimmter Stoffe in die Vorfluter zu begrenzen.<br />
Sie verringern das Ausmaß der Erosion <strong>und</strong> damit den Eintrag von Stoffen, die an Bodenteilchen geb<strong>und</strong>en<br />
sind, wie Nitrat <strong>und</strong> Phosphat. Zur spürbaren Verringerung der Nitrat- <strong>und</strong> Phosphat-Werte in Quellen<br />
<strong>und</strong> Bächen können Gewässerrandstreifen jedoch nur unwesentlich beitragen. Hier ist in erster Linie eine<br />
Veränderung der Bodenbearbeitung bzw. –bewirtschaftung (z.B. verlustarme bodennahe Ausbringungstechniken),<br />
der Düngepraktiken (Menge, Verteilung, Düngeart), eine Reduzierung der Viehbestandsdichte, eine<br />
längere Vegetationsbedeckung (z.B. auch Fruchtfolgen) <strong>und</strong> eine Nutzungsänderung auf den angrenzenden<br />
Ackerflächen (z.B. Schlaggestaltung, Extensivierung) zu empfehlen.<br />
Ein wesentlicher Entwicklungsschwerpunkt im <strong>Saarland</strong> liegt auf der Sicherung <strong>und</strong> Sanierung von Auen, die<br />
als Gunststandorte für die Landwirtschaft <strong>und</strong> die Siedlungsentwicklung heute zu den am stärksten überformten<br />
Lebensräumen, insbesondere im Verdichtungsraum, zählen. Im Vordergr<strong>und</strong> steht die Sicherung<br />
naturnaher Auen, allerdings wird in einigen Bereichen auch eine Reaktivierung der Auendynamik angestrebt<br />
(siehe Karte „Oberflächengewässer <strong>und</strong> Auen“). Die Auswirkungen einer Reaktivierung auf die landwirtschaftliche<br />
Nutzung müssen im Vorfeld geprüft werden. Eine naturnähere Entwicklung der Auenlebensräume<br />
impliziert auch die Vermeidung landwirtschaftlicher Intensivnutzungen, wie beispielsweise Ackerbau in<br />
der Aue <strong>und</strong> hohe Beweidungsintensitäten. Die Erhaltung <strong>und</strong> Entwicklung einer extensiven Grünlandnutzung<br />
in den Offenlandauen zählt zu den prioritären Maßnahmen zum Schutz der Auen <strong>und</strong> Fließgewässer.<br />
Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Fliessgewässern <strong>und</strong> Auen<br />
Konflikt „Begradigung <strong>und</strong> Intensivnutzungen im Uferbereich“:<br />
Extensivierung von Gewässerrandstreifen, Entwicklung von Ufergehölzsäumen,<br />
Anlage von Tränken <strong>und</strong> Furten für das Vieh, Auszäunung der Gewässerufer (siehe Karte „Waldwirtschaft<br />
<strong>und</strong> Landwirtschaft“),<br />
erosionsmindernde Maßnahmen in angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen durchführen sowie<br />
Verminderung des Düngereintrags in den angrenzenden Ackerflächen.<br />
Konflikt „Boden- <strong>und</strong> Stoffeintrag“ sowie „Belastung der Wasserqualität durch Ackernutzung in der<br />
Aue“:<br />
Umwandlung der Ackerflächen in Dauergrünland (siehe Karte „Waldwirtschaft <strong>und</strong> Landwirtschaft“).<br />
Konflikt „Intensivnutzung in Auen“:<br />
Erhaltung <strong>und</strong> Entwicklung extensiver Grünlandnutzung in den Auen (Mahd, leichte Rinderrassen, Auszäunung<br />
sehr nasser Bereiche) sowie<br />
Extensivierung der Beweidung in Auen (siehe Karte „Waldwirtschaft <strong>und</strong> Landwirtschaft“).<br />
Konflikt „Beeinträchtigung von Quellbereichen“:<br />
Auszäunen von Quellen sowie<br />
Verminderung des Düngereintrags in den angrenzenden Ackerflächen.<br />
10.5.3 Bodenschutz<br />
In der landwirtschaftlichen Bodennutzung basiert die größte Gefährdung des Naturgutes Boden auf bodenerosiven<br />
Prozessen im Bereich hängiger Ackerbaugebiete.<br />
Für die landwirtschaftlich genutzte Fläche wurden diejenigen Bereiche als potenziell stark erosionsgefährdet<br />
bestimmt, die für eine ackerbauliche Nutzung aus bodenk<strong>und</strong>licher Sicht nur bedingt geeignet sind bzw. wo<br />
erosionsmindernde Maßnahmen erforderlich werden. Der Schwerpunkt liegt im Bereich des Prims-Blies-<br />
Hügellandes, wo stark schluffhaltige Deckschichten über älteren Tonschichten des Karbons aufliegen oder<br />
136