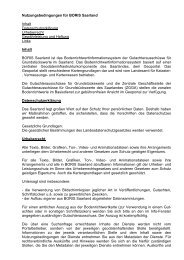Begründung und Erläuterungsbericht - Geoportal Saarland
Begründung und Erläuterungsbericht - Geoportal Saarland
Begründung und Erläuterungsbericht - Geoportal Saarland
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Landschaftsprogramm <strong>Saarland</strong><br />
Boden <strong>und</strong> Relief<br />
Da die Hanglänge der Nutzflächen parzellierungsbedingt variiert <strong>und</strong> lokale Differenzierungen wie Ackerterrassen<br />
nicht berücksichtigt werden konnten, muss der Erosionsverdacht vor Ort im Rahmen der kommunalen<br />
Landschaftsplanung überprüft werden.<br />
Schwerpunkträume aktueller Bodenerosion<br />
Zusammenhängende erosionsverdächtige Bereiche (> 40 ha) mit teilweise erkennbaren Erosionsereignissen<br />
werden als Schwerpunkträume aktueller Bodenerosion (siehe Karte „Klima – Boden – Gr<strong>und</strong>wasser“) bezeichnet.<br />
Hier hat die Durchführung erosionsmindernder Maßnahmen oberste Priorität. Die teilweise großflächigen<br />
Handlungsschwerpunkte befinden sich ganz überwiegend im nordöstlichen <strong>und</strong> mittleren <strong>Saarland</strong> in<br />
den ackerbaulich genutzten Bereichen der sehr erosionsempfindlichen Böden des Rotliegenden, verb<strong>und</strong>en<br />
mit erheblichen Hangneigungen zwischen 7° <strong>und</strong> 20°. Kleinflächigere Erosionsschwerpunkte kommen im<br />
Köllerbachtal <strong>und</strong> im Bliesgau vor. Im Rahmen der kommunalen Landschaftsplanung sind die erosionsverdächtigen<br />
Bereiche räumlich weiter zu konkretisieren. Die Erosionsschwerpunkte im Stadtverband Saarbrücken<br />
wurden bereits mit dem Modellprojekt Landwirtschaft des Stadtverbandes abgestimmt <strong>und</strong> daher auch<br />
bei relativ geringer Flächengröße übernommen.<br />
Erosionsmindernde Maßnahmen sind in erster Linie in ackerbaulich genutzten Schwerpunkträumen aktueller<br />
Bodenerosion durchzuführen. Umfang <strong>und</strong> Art der Maßnahmen sind auf die jeweilige Problemsituation vor<br />
Ort <strong>und</strong> die Betriebsstrukturen abzustimmen.<br />
Maßnahmen zur Erosionsminderung<br />
Bodenerosion wird verursacht durch oberflächliches Abfließen von Niederschlagswasser. Oberflächenabfluss<br />
entsteht, wenn Niederschläge auf Gr<strong>und</strong> von z.B. Verkrustung, Verschlämmung, Verdichtung oder Niederschlagssättigung<br />
des Bodens nicht schnell genug in den Boden eindringen <strong>und</strong> versickern können. Maßnahmen,<br />
die auf eine Verringerung der Bodenerosion durch Wasser abzielen, müssen stets eine Verbesserung<br />
<strong>und</strong> Pflege der Bodenstruktur <strong>und</strong> damit des Wasseraufnahmevermögens des Bodens bewirken. Hierunter<br />
fallen Maßnahmen wie, z.B. das Belassen der Ernterückstände an der Ackeroberfläche, die Aufweitung<br />
der Fruchtfolge <strong>und</strong> bodenschonende Bearbeitungsverfahren. Gleichzeitig kann die erosionswirksame<br />
Hanglänge durch hangparallele lineare Strukturen reduziert werden, so dass auch die Anlage von Grünlandstreifen<br />
oder Hecken zentrale Maßnahmen für den Bodenschutz darstellen. Bei sehr stark erosionsgefährdeten<br />
Böden kann die Umwandlung der Ackerfläche in Dauergrünland als wirksamster Erosionsschutz erforderlich<br />
werden.<br />
Eine Realisierung dauerhafter Maßnahmen (Pflanzungen, Grünland- <strong>und</strong> Brachestreifen) kann über ein<br />
(kommunales) Ökokonto erfolgen. Hierbei ist zu beachten, dass Maßnahmen in offenen Agrarlandschaften,<br />
die auf Gr<strong>und</strong> ihrer Strukturarmut eine hohe Bedeutung als Rast-, zum Teil auch Brutplatz gefährdeter Vogelarten<br />
des Offenlandes (Kiebitz, Goldregenpfeifer, Mornellregenpfeifer) haben, sorgfältig mit den Belangen<br />
des Vogelschutzes abzustimmen sind. Weiterhin werden über die freiwilligen Agrarumweltmaßnahmen erosionsmindernde,<br />
landwirtschaftliche Verfahren gefördert (Umwandlung von Ackerland in Grünland, Mulch<strong>und</strong><br />
Direktsaatverfahren). Es ist zudem davon auszugehen, dass die Empfänger von Direktzahlungen für<br />
Erosionsschutz auf gefährdeten Flächen sorgen müssen (Cross-Compliance-Vorgaben).<br />
2.4.3 Bodenverdichtung<br />
Bei landwirtschaftlichen Kulturen ist eine Bodenbearbeitung erforderlich, wenn ein neuer Pflanzenbestand<br />
angelegt oder vorhandene Kulturen gepflegt werden müssen. Bodenbearbeitungen erfolgen in der Regel mit<br />
Maschineneinsatz. Das Befahren des Bodens mit schweren Maschinen kann zu anthropogenen Bodenverdichtungen<br />
führen. Hierunter versteht man eine ungewollte Veränderung des Bodengefüges, Abnahme des<br />
Porenraums <strong>und</strong> Verschlechterung des Wasser-, Luft-, Wärme <strong>und</strong> Nährstoffhaushaltes durch mechanische<br />
Belastungen, die mit einer vertikalen Höhenveränderung <strong>und</strong> gleichzeitiger Scherung von Bodenvolumina<br />
einhergehen.<br />
Bodenverdichtungen durch schweren Maschineneinsatz bei nicht angepasstem Feuchtestatus oder Befahren<br />
mit zu großem Schlupf sind gr<strong>und</strong>sätzlich zu vermeiden.<br />
Im Rahmen der Forstwirtschaft ist darauf zu achten, dass beim Holzeinschlag durch das Schlagen, Bergen<br />
<strong>und</strong> Rücken der Baumstämme keine Bodenverdichtungen verursacht werden. Die Festlegung von Rückegassenabständen<br />
(40 m mit einer Breite von 3,5 – 4 m) in den Waldbaurichtlinien dient diesem Gr<strong>und</strong>satz.<br />
16