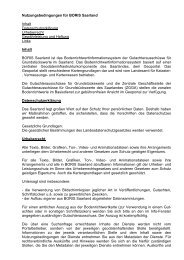Begründung und Erläuterungsbericht - Geoportal Saarland
Begründung und Erläuterungsbericht - Geoportal Saarland
Begründung und Erläuterungsbericht - Geoportal Saarland
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Landschaftsprogramm <strong>Saarland</strong><br />
Siedlung <strong>und</strong> Verkehr<br />
schen Dillingen <strong>und</strong> Saarbrücken gehört zu den am dichtesten besiedelten Räumen in Deutschland. Die<br />
entstandene Stadtlandschaft trägt bis heute die Merkmale einer Bergbaufolgelandschaft <strong>und</strong> Alt-<br />
Industrieregion. Typisch für den altindustriell geprägten Ballungsraum sind die Konzentration der Industrie<strong>und</strong><br />
Gewerbegebiete in den Talauen, die Gewerbe- <strong>und</strong> Industriebrachen, gewerblich untergenutzte Bereiche,<br />
Gewerbebrachen <strong>und</strong> Resträume entlang der Bahnanlagen.<br />
Im Zuge des nach der Stahlkrise verstärkten Umbaus der Saarwirtschaft entstanden nun großflächige Industrieansiedlungen<br />
auch außerhalb der Auen, so beispielsweise das Gewerbegebiet Saarbücken-Süd, das<br />
– zusammen mit der B<strong>und</strong>esautobahn A 6 – den Südraum Saarbrückens prägt.<br />
Der systematische Ausbau des Straßennetzes seit den 1960er Jahren führte – in Wechselwirkung mit der<br />
Suburbanisierung des Gesamtraumes – zu einer drastischen Steigerung des Verkehrsaufkommens <strong>und</strong> der<br />
Monofunktionalisierung der Straßenräume – mit den bekannten Zerschneidungswirkungen.<br />
Die Zunahme an Gebäude-, Frei- <strong>und</strong> Verkehrsflächen konzentrierte sich in den 1990er Jahren auf die ländlich<br />
geprägten Bereiche, während der Stadtverband Saarbrücken <strong>und</strong> Neunkirchen die geringsten prozentualen<br />
Zuwächse aufweisen. Dies spiegelt die Suburbanisierungstendenz in den ländlichen Bereichen wider.<br />
Die Funktionstrennung in zentrale Bereiche mit einem hohen Arbeitsplatzangebot <strong>und</strong> in Wohnstandorte<br />
außerhalb induziert hohe Pendlerzahlen <strong>und</strong> ein hohes Verkehrsaufkommen.<br />
Heute befindet sich das <strong>Saarland</strong> im Prozess eines tief greifenden Strukturwandels. Der Montanbereich wird<br />
modernisiert, die industrielle Diversifizierung gefördert. Der Dienstleistungssektor expandiert stark. Wachstumsbranchen<br />
wie Elektronik <strong>und</strong> Telekommunikation werden bevorzugt angesiedelt. Die Region soll sich zu<br />
einem Standort mit hoher Lebensqualität <strong>und</strong> attraktiven Erholungsangeboten entwickeln.<br />
11.2 Nachhaltige Siedlungs- <strong>und</strong> Verkehrsentwicklung<br />
Der Begriff der Nachhaltigkeit läßt sich auf bestehende Siedlungs- <strong>und</strong> Verkehrssysteme nur bedingt anwenden.<br />
Der mit diesen Systemen verb<strong>und</strong>ene Stoff- <strong>und</strong> Energiefluss, aber auch soziokulturelle Auswirkungen<br />
<strong>und</strong> ökonomische Rahmenbedingungen verursachen eine Reihe von sozialen, wirtschaftlichen <strong>und</strong><br />
ökologischen Problemen, die nicht im Sinne einer Nachhaltigkeit des Gesamtsystems „Siedlung“, sondern<br />
eher im Sinne einer Optimierung von Teilaspekten gelöst werden können. Die stadt- <strong>und</strong> verkehrsplanerischen<br />
Leitbilder des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts spiegeln die Auseinandersetzung mit den Raumansprüchen der Industriegesellschaft<br />
sowie planerische Lösungsansätze für daraus entstehende Belastungen wider. Vielfach<br />
führten Optimierungsversuche wie beispielsweise der Ausbau des Straßennetzes zur Bewältigung des steigenden<br />
Verkehrsaufkommens oder die Funktionstrennung zur Nutzungsentflechtung von Gemengelagen zu<br />
weiter steigenden Belastungen bzw. Beanspruchung des Umlandes. Das Umland – oder im regionalen<br />
Maßstab der ländliche Raum – wurde als „Ausgleichsraum“ für die Siedlungs- <strong>und</strong> Verkehrssysteme funktionalisiert.<br />
Mit Leitbildern wie die "Gartenstadt", "Neues Bauen" <strong>und</strong> "funktionalistische Trennung" städtischer Gr<strong>und</strong>funktionen<br />
wurde dem Wohnbereich eine periphere Existenz zugeordnet, um vermeintlich bessere Lebens<strong>und</strong><br />
Wohnbedingungen, also den Ausgleichsraum innerhalb der Siedlung zu realisieren. Damit einher ging<br />
einerseits ein Verlust an Urbanität <strong>und</strong> die "Entstädterung" der Stadt, andererseits die Verstädterung großer<br />
Räume. Aus ehemaligen Dörfern entstanden Stadtteile, Vororte, Trabantensiedlungen, Pendler- <strong>und</strong> Wohnorte.<br />
Der Gr<strong>und</strong>stein für die Auflösung der Städte <strong>und</strong> die Entstehung heutiger Stadt-Landschaften wurde<br />
bereits früh gelegt.<br />
Der Gedanke der Funktionstrennung brachte das Auto, welches zuvor als Überlandfahrzeug bzw. für den<br />
„Freizeitverkehr“ genutzt wurde, in die Städte <strong>und</strong> verdrängte Fußgänger, Radfahrer, aber auch Straßenbahnen.<br />
Viele während des 2. Weltkrieges entwickelte Wiederaufbaupläne autogerechter Städte wurden in<br />
der Nachkriegszeit umgesetzt; die Kriegszerstörungen machten den Umbau der Städte möglich.<br />
Im Städtebau ging man von einer integrierten Stadtplanung zur „Optimierung einzelner Bauaufgaben“ über.<br />
Funktionstrennung, Fragmentierung <strong>und</strong> Suburbanisierung prägen – als Ergebnis dieser Zeit – die Städte<br />
bzw. Stadtregionen bis heute.<br />
Erst seit Mitte der 1970er Jahre fand eine Rückbesinnung auf gewachsene Siedlungsstrukturen, auf Stadt<strong>und</strong><br />
Dorfgeschichte statt. Das Instrumentarium der Städtebausanierungs- <strong>und</strong> Dorferneuerungsmaßnahmen<br />
143