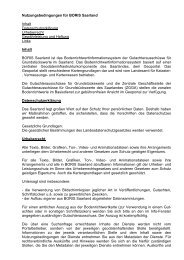Begründung und Erläuterungsbericht - Geoportal Saarland
Begründung und Erläuterungsbericht - Geoportal Saarland
Begründung und Erläuterungsbericht - Geoportal Saarland
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Landschaftsprogramm <strong>Saarland</strong><br />
Siedlung <strong>und</strong> Verkehr<br />
Handlungsdruck oder ein hohes Potenzial zur Entwicklung der Kulturlandschaft aufweisen. Dem kommunalen<br />
Landschaftsplan bleibt es vorbehalten, einzelne Maßnahmenbereiche zu priorisieren <strong>und</strong> zu konkretisieren.<br />
Um auch für die besondere Konfliktlage im Ordnungsraum planerisch <strong>und</strong> finanziell aufwändigere Kompensationsmaßnahmen<br />
forcieren zu können, sind bei der Ausgestaltung des Ökokontos allerdings folgende<br />
Voraussetzungen zu erfüllen:<br />
Die ökologische Aufwertung der abiotischen Naturgüter <strong>und</strong> der funktionalen Beziehungen im Naturhaushalt<br />
muss im Rahmen der Bilanzierung besondere Berücksichtigung finden, damit Maßnahmen wie Gewässerrenaturierungen/Gewässerstrukturverbesserungen<br />
<strong>und</strong> Entsiegelungen gegenüber Aufforstungen<br />
<strong>und</strong> Sukzession „konkurrenzfähig“ werden.<br />
Die räumliche Bindung der Kompensationsmaßnahmen zum Eingriff sollte zumindest auf Naturraumebene<br />
gewährleistet werden, um eine „Verschiebung“ von Kompensationsmaßnahmen aus dem Ordnungsraum<br />
in die peripheren ländlichen Räume zu verhindern.<br />
11.8 Verkehr <strong>und</strong> Schutz von unzerschnittenen Räumen<br />
Mobilität ist eine wesentliche Voraussetzung für das Funktionieren unserer heutigen Gesellschaft. Betroffen<br />
sind nahezu alle Bereiche des privaten <strong>und</strong> öffentlichen Lebens. Die Anforderungen an die Mobilität im beruflichen<br />
wie im Freizeitsektor steigen zunehmend vor dem Hintergr<strong>und</strong> der Globalisierung. Sowohl der<br />
Fernverkehr als auch die Regional- <strong>und</strong> Lokalverkehre müssen heute möglichst reibungslos funktionieren.<br />
Dies betrifft alle Verkehrsmittel <strong>und</strong> Infrastrukturen, sowohl den nichtmotorisierten als auch den motorisierten<br />
Verkehr.<br />
Zur Reduzierung der (externalisierten) Kosten des Verkehrs sind die Vermeidung von Verkehr <strong>und</strong> die Verlagerung<br />
der Verkehrsströme auf Verkehrsmittel des Umweltverb<strong>und</strong>es anzustreben. Die kann erfolgen<br />
durch:<br />
Funktionsgemischte Siedlungsstrukturen sowie durch die Bündelung von Wegen.<br />
Eine Verkehrsverlagerung, welche die konsequente Steigerung der Attraktivität des Öffentlichen Verkehrs<br />
in der Fläche sowie eine Verbesserung des Angebotes für Radfahrer <strong>und</strong> Fußgänger voraussetzt.<br />
Die kommunale Verkehrsentwicklungsplanung, welche in der Gesamtschau alle Potenziale zur Verkehrsvermeidung,<br />
-verlagerung <strong>und</strong> -entschärfung aufzeigt.<br />
Die einseitige Funktionalisierung des Straßenraumes für den motorisierten Individualverkehr (MIV) sollte<br />
durch Umgestaltung zugunsten des Umweltverb<strong>und</strong>es zurückgenommen werden. Erholungsrelevante Grünflächen<br />
in hoch verdichteten Räumen sollen aktiv durch Lärmschutzmaßnahmen entlastet werden Eine Verbesserung<br />
der durch Lärm- <strong>und</strong> Schadstoffimmissionen beeinträchtigten Wohn- <strong>und</strong> Freiraumsituationen<br />
kann nur über eine Entschärfung der durch den MIV verursachten Probleme gelingen.<br />
Schutz von unzerschnittenen Räumen<br />
Verkehrstrassen beeinträchtigen unterschiedliche Raumfunktionen. Die Barrierewirkung von Straßen betrifft<br />
Menschen (physische <strong>und</strong> soziale Barrierewirkung, Zugänglichkeit von Siedlungsstrukturen, Landwirtschaftsflächen,<br />
Freiräumen etc.) <strong>und</strong> Tiere (Verinselung). Zudem werden natürliche raumfunktionelle Zusammenhänge<br />
wie Luft- <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>wasserströmungen sowie Fließgewässersysteme unterbrochen. Handlungsspielräume<br />
zur Reduktion der Barrierewirkung für Fußgänger bestehen auf nahezu allen innerörtlichen Straßen<br />
im Rahmen einer Reduktion von Straßenbreiten <strong>und</strong> der Erhöhung des Angebots von Querungshilfen. Eine<br />
effektive Minimierung der Trennwirkungen lässt sich für Tierpopulationen im Ballungsraum mit vertretbarem<br />
Aufwand nicht erreichen. Aus diesem Gr<strong>und</strong> muss der Schutz zusammenhängender, bislang noch wenig<br />
zerschnittener Freiräume Vorrang genießen.<br />
In unzerschnittenen Räume im Sinne von § 6 Abs. 1 SNG sind unvermeidbare Zerschneidungen nur aus<br />
überwiegenden Gründen des Gemeinwohls oder auf Gr<strong>und</strong> von Verkehrswegeausbaugesetzen zulässig. Sie<br />
sind in ihrer Zerschneidungswirkung durch den Bau von Querungshilfen zu minimieren (§ 6 Abs. 3 SNG).<br />
Im Landschaftsprogramm werden gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 SNG die unzerschnittenen Räume im Sinne von §<br />
6 Abs.1 SNG dargestellt (siehe Kartendienst „Schutzgebietskategorien des Lapro“). Auf die entsprechenden<br />
Ausführungen in Kapitel 6.4 wird hingewiesen.<br />
155