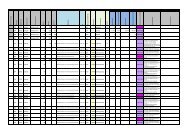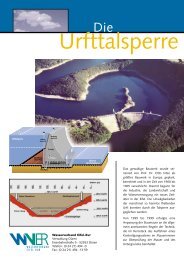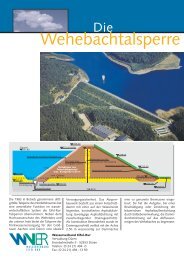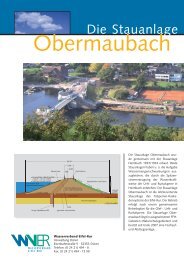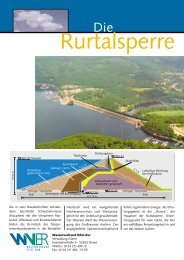Jahresbericht 2004 - Wasserverband Eifel-Rur
Jahresbericht 2004 - Wasserverband Eifel-Rur
Jahresbericht 2004 - Wasserverband Eifel-Rur
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Erste Betriebserfahrungen nach vollständiger<br />
Inbetriebnahme des Bauwerks<br />
zeigen, dass im nachgeschalteten<br />
Erdbecken kaum Störstoffe wie beispielsweise<br />
Toilettenpapier vorzufinden<br />
sind. Der Reinigungsaufwand für das<br />
Betriebspersonal verringert sich dadurch<br />
erheblich.<br />
Mit dieser Rechenanlagen im Ablauf<br />
des Regenüberlaufbeckens erreicht der<br />
Verband eine qualitative Verbesserung<br />
für das Gewässer und leistet so einen<br />
Schritt zum sichtbaren Umweltschutz.<br />
Forschungsprojekt<br />
Membrankläranlage<br />
Simmerath<br />
In der Nord-<strong>Eifel</strong>, wo zahlreiche<br />
Kläranlagen im direkten<br />
Wasser-Einzugsgebiet von<br />
Trinkwassertalsperren liegen,<br />
wird die Membrantechnik in<br />
Zukunft an Bedeutung gewinnen.<br />
Vor diesem Hintergrund<br />
betreibt der WVER auf dem<br />
Klärwerk Simmerath eine Versuchsmembrankläranlage.<br />
Ein Aachener Unternehmen<br />
hat neuartige Membranmodule<br />
für den Einsatz in kommunalen<br />
Kläranlagen entwickelt.<br />
Diese funktionieren nach dem<br />
Prinzip poröser Membranen, die in die<br />
Biologie abgetaucht werden und dabei<br />
nahezu keimfreies Wasser liefern.<br />
Hauptelemente der Membranmodule<br />
sind dünne Röhrchen, die aus Kunststoff<br />
hergestellt werden. Die Poren der<br />
Membran sind derart klein, dass sie für<br />
viele Mikroorganismen, wie Viren, Bakterien<br />
und insbesondere Krankheitserreger<br />
eine echte Barriere darstellen.<br />
Seit März 2003 werden zwei Membranmodule<br />
mit je 500 m2 Membranfläche<br />
unter realen Verhältnissen betrieben<br />
und optimiert. Nach einer Be-<br />
Abwassertechnik 29<br />
lastungsphase der Membranen mit<br />
kontinuierlich gleichbleibendem Zulauf<br />
bei der Inbetriebnahme der Anlage erfolgte<br />
im Anschluss daran die dynamische<br />
Belastung entsprechend der Zuflussdynamik<br />
der Großanlage. Dabei<br />
ist die Aufrechterhaltung einer möglichst<br />
hohen Durchsatzrate (Permeabilität)<br />
ein wesentlicher Untersuchungspunkt.<br />
Dies kann durch optimale Abstimmung<br />
von Filtration, Rückspülung<br />
und Spüllufteinsatz erreicht werden.<br />
Geht die Permeabilität zu weit zurück,<br />
wird eine chemische Reinigung der<br />
Membran erforderlich. Hierzu wurden<br />
an der Versuchsanlage verschiedene<br />
Konzepte hinsichtlich ihrer Reinigungswirkung<br />
untersucht. Parallel zu den<br />
Untersuchungen im Bereich der Membranen<br />
wurde natürlich auch die biologische<br />
Stufe in die Untersuchungen<br />
eingeschlossen. Hier wurden insbesondere<br />
die verschiedenen Betriebsweisen<br />
der biologischen Stufe und deren Zusammenspiel<br />
mit der Membranfiltration<br />
ausgewertet, mit dem Ziel das<br />
Verhalten einer solchen Membrankläranlage<br />
abschätzen zu können.<br />
Die Leistungsfähigkeit der Anlage hinsichtlich<br />
der Ablaufergebnisse und<br />
Keimrückhalts wurde kontinuierlich dokumentiert<br />
und ausgewertet.<br />
Anordnung des<br />
Siebs an der Überlaufkante<br />
(Sicht<br />
von unten)<br />
links: Blick auf die<br />
Belebungsstufe<br />
sowie die Membranhalle<br />
rechts: Einsetzen<br />
eines Membranmoduls<br />
in die<br />
Versuchsanlage