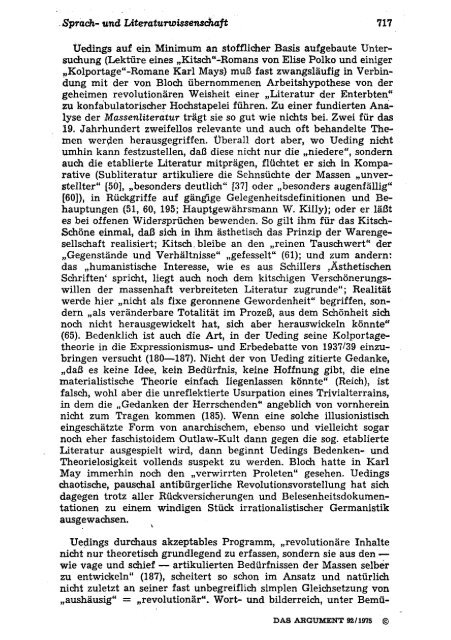Das Argument - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Das Argument - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Das Argument - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Sprach- und Literaturwissenschaft 717<br />
Uedings auf ein Minimum an stofflicher Basis aufgebaute Untersuchung<br />
(Lektüre eines „Kitsch"-Romans von Elise Polko und einiger<br />
„Kolportage"-Romane Karl Mays) muß fast zwangsläufig in Verbindung<br />
mit der von Bloch übernommenen Arbeitshypothese von der<br />
geheimen revolutionären Weisheit einer „Literatur der Enterbten"<br />
zu konfabulatorischer Hochstapelei führen. Zu einer fundierten Analyse<br />
der Massenliteratur trägt sie so gut wie nichts bei. Zwei für das<br />
19. Jahrhundert zweifellos relevante und auch oft behandelte Themen<br />
werben herausgegriffen. Überall dort aber, wo Ueding nicht<br />
umhin kann festzustellen, daß diese nicht nur die „niedere", sondern<br />
auch die etablierte Literatur mitprägen, flüchtet er sich in Komparative<br />
(Subliteratur artikuliere die Sehnsüchte der Massen „unverstellter"<br />
[50], „besonders deutlich" [37] oder „besonders augenfällig"<br />
[60]), in Rückgriffe auf gängige Gelegenheitsdefinitionen und Behauptungen<br />
(51, 60, 195; Hauptgewährsmann W. Killy); oder er läßt<br />
es bei offenen Widersprüchen bewenden. So gilt ihm für das Kitsch-<br />
Schöne einmal, daß sich in ihm ästhetisch das Prinzip der Warengesellschaft<br />
realisiert; Kitsch, bleibe an den „reinen Tauschwert" der<br />
„Gegenstände und Verhältnisse" „gefesselt" (61); und zum andern:<br />
das „humanistische Interesse, wie es aus Schillers ,Ästhetischen<br />
Schriften' spricht, liegt auch noch dem kitschigen Verschönerungswillen<br />
der massenhaft verbreiteten Literatur zugrunde"; Realität<br />
werde hier „nicht als fixe geronnene Gewordenheit" begriffen, sondern<br />
„als veränderbare Totalität im Prozeß, aus dem Schönheit sich<br />
noch nicht herausgewickelt hat, sich aber herauswickeln könnte"<br />
(65). Bedenklich ist auch die Art, in der Ueding seine Kolportagetheorie<br />
in die Expressionismus- und Erbedebatte von 1937/39 einzubringen<br />
versucht (180—187). Nicht der von Ueding zitierte Gedanke,<br />
„daß es keine Idee, kein Bedürfnis, keine Hoffnung gibt, die eine<br />
materialistische <strong>Theorie</strong> einfach liegenlassen könnte" (Reich), ist<br />
falsch, wohl aber die unreflektierte Usurpation eines Trivialterrains,<br />
in dem die „Gedanken der Herrschenden" angeblich von vornherein<br />
nicht zum Tragen kommen (185). Wenn eine solche illusionistisch<br />
eingeschätzte Form von anarchischem, ebenso und vielleicht sogar<br />
noch eher faschistoidem Outlaw-Kult dann gegen die sog. etablierte<br />
Literatur ausgespielt wird, dann beginnt Uedings Bedenken- und<br />
<strong>Theorie</strong>losigkeit vollends suspekt zu werden. Bloch hatte in Karl<br />
May immerhin noch den „verwirrten Proleten" gesehen. Uedings<br />
chaotische, pauschal antibürgerliche Revolutionsvorstellung hat sich<br />
dagegen trotz aller Rückversicherungen und Belesenheitsdokumentationen<br />
zu einem windigen Stück irrationalistischer Germanistik<br />
ausgewachsen.<br />
Uedings durchaus akzeptables Programm, „revolutionäre Inhalte<br />
nicht nur theoretisch grundlegend zu erfassen, sondern sie aus den —<br />
wie vage und schief — artikulierten Bedürfnissen der Massen selber<br />
zu entwickeln" (187), scheitert so schon im Ansatz und natürlich<br />
nicht zuletzt an seiner fast unbegreiflich simplen Gleichsetzung von<br />
„aushäusig" = „revolutionär". Wort- und bilderreich, unter Bemü-<br />
DAS ARGUMENT 92/1975 ©,