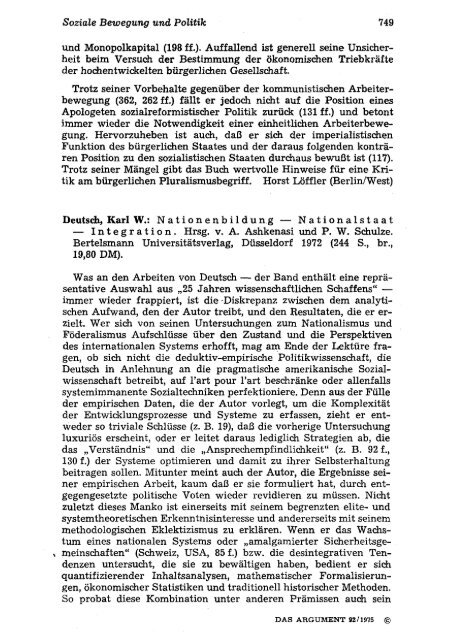Das Argument - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Das Argument - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Das Argument - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Soziale Bewegung und Politik 749<br />
und Monopolkapital (198 ff.)- Auffallend ist generell seine Unsicherheit<br />
beim Versuch der Bestimmung der ökonomischen Triebkräfte<br />
der hochentwickelten bürgerlichen Gesellschaft.<br />
Trotz seiner Vorbehalte gegenüber der kommunistischen Arbeiterbewegung<br />
(362, 262 ff.) fällt er jedoch nicht auf die Position eines<br />
Apologeten sozialreformistischer Politik zurück (131 ff.) und betont<br />
immer wieder die Notwendigkeit einer einheitlichen Arbeiterbewegung.<br />
Hervorzuheben ist auch, daß er sich der imperialistischen<br />
Funktion des bürgerlichen Staates und der daraus folgenden konträren<br />
Position zu den sozialistischen Staaten durchaus bewußt ist (117).<br />
Trotz seiner Mängel gibt das Buch wertvolle Hinweise für eine Kritik<br />
am bürgerlichen Pluralismusbegriff. Horst Löffler (Berlin/West)<br />
Deutsch, Karl W.: Nationenbildung — Nationalstaat<br />
— Integration. Hrsg. v. A. Ashkenasi und P. W. Schulze.<br />
Bertelsmann Universitätsverlag, Düsseldorf 1972 (244 S., br.,<br />
19,80 DM).<br />
Was an den Arbeiten von Deutsch — der Band enthält eine repräsentative<br />
Auswahl aus „25 Jahren wissenschaftlichen Schaffens" —<br />
immer wieder frappiert, ist die Diskrepanz zwischen dem analytischen<br />
Aufwand, den der Autor treibt, und den Resultaten, die er erzielt.<br />
Wer sich von seinen Untersuchungen zum Nationalismus und<br />
Föderalismus Aufschlüsse über den Zustand und die Perspektiven<br />
des internationalen Systems erhofft, mag am Ende der Lektüre fragen,<br />
ob sich nicht die deduktiv-empirische Politikwissenschaft, die<br />
Deutsch in Anlehnung an die pragmatische amerikanische Sozialwissenschaft<br />
betreibt, auf l'art pour l'art beschränke oder allenfalls<br />
systemimmanente Sozialtechniken perfektioniere. Denn aus der Fülle<br />
der empirischen Daten, die der Autor vorlegt, um die Komplexität<br />
der Entwicklungsprozesse und Systeme zu erfassen, zieht er entweder<br />
so triviale Schlüsse (z. B. 19), daß die vorherige Untersuchung<br />
luxuriös erscheint, oder er leitet daraus lediglich Strategien ab, die<br />
das „Verständnis" und die „Ansprechempfindlichkeit" (z. B. 92 f.,<br />
130 f.) der Systeme optimieren und damit zu ihrer Selbsterhaltung<br />
beitragen sollen. Mitunter meint auch der Autor, die Ergebnisse seiner<br />
empirischen Arbeit, kaum daß er sie formuliert hat, durch entgegengesetzte<br />
politische Voten wieder revidieren zu müssen. Nicht<br />
zuletzt dieses Manko ist einerseits mit seinem begrenzten elite- und<br />
systemtheoretischen Erkenntnisinteresse und andererseits mit seinem<br />
methodologischen Eklektizismus zu erklären. Wenn er das Wachstum<br />
eines nationalen Systems oder „amalgamierter Sicherheitsge-<br />
, meinschaften" (Schweiz, USA, 85 f.) bzw. die desintegrativen Tendenzen<br />
untersucht, die sie zu bewältigen haben, bedient er sich<br />
quantifizierender Inhaltsanalysen, mathematischer Formalisierungen,<br />
ökonomischer Statistiken und traditionell historischer Methoden.<br />
So probat diese Kombination unter anderen Prämissen auch sein<br />
DAS ARGUMENT 92/1975 ©