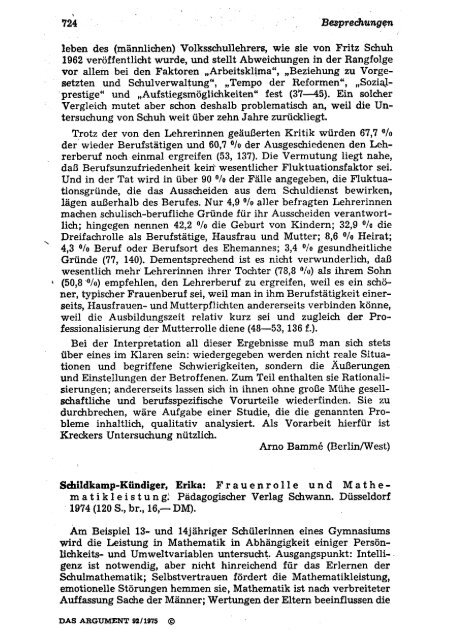Das Argument - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Das Argument - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Das Argument - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
724<br />
1 Besprechungen<br />
1<br />
leben des (männlichen) Volksschullehrers, wie sie von Fritz Schuh<br />
1962 veröffentlicht wurde, und stellt Abweichungen in der Rangfolge<br />
vor allem bei den Faktoren „Arbeitsklima", „Beziehung zu Vorgesetzten<br />
und Schulverwaltung", „Tempo der Reformen", „Sozialprestige"<br />
und „Aufstiegsmöglichkeiten" fest (37—45). Ein solcher<br />
Vergleich mutet aber schon deshalb problematisch an, weil die Untersuchung<br />
von Schuh weit über zehn Jahre zurückliegt.<br />
Trotz der von den Lehrerinnen geäußerten Kritik würden 67,7 °/o<br />
der wieder Berufstätigen und 60,7 °/o der Ausgeschiedenen den Lehrerberuf<br />
noch einmal ergreifen (53, 137). Die Vermutung liegt nahe,<br />
daß Berufsunzufriedenheit kein" wesentlicher Fluktuationsfaktor sei.<br />
Und in der Tat wird in über 90 °/o der Fälle angegeben, die Fluktuationsgründe,<br />
die das Ausscheiden aus dem Schuldienst bewirken,<br />
lägen außerhalb des Berufes. Nur 4,9 %> aller befragten Lehrerinnen<br />
machen schulisch-berufliche Gründe für ihr Ausscheiden verantwortlich;<br />
hingegen nennen 42,2 °/o die Geburt von Kindern; 32,9 % die<br />
Dreifachrolle als Berufstätige, Hausfrau und Mutter; 8,6 % Heirat;<br />
4,3 °/o Beruf oder Berufsort des Ehemannes; 3,4 °/o gesundheitliche<br />
Gründe (77, 140). Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, daß<br />
wesentlich mehr Lehrerinnen ihrer Tochter (78,8 °/o) als ihrem Sohn<br />
(50,8 °/o) empfehlen, den Lehrerberuf zu ergreifen, weil es ein schöner,<br />
typischer Frauenberuf sei, weil man in ihm Berufstätigkeit einerseits,<br />
Hausfrauen- und Mutterpflichten andererseits verbinden könne,<br />
weil die Ausbildungszeit relativ kurz sei und zugleich der Professionalisierung<br />
der Mutterrolle diene (48—53,136 f.).<br />
Bei der Interpretation all dieser Ergebnisse muß man sich stets<br />
über eines im Klaren sein: wiedergegeben werden nicht reale Situationen<br />
und begriffene Schwierigkeiten, sondern die Äußerungen<br />
und Einstellungen der Betroffenen. Zum Teil enthalten sie Rationalisierungen;<br />
andererseits lassen sich in ihnen ohne große Mühe gesellschaftliche<br />
und berufsspezifische Vorurteile wiederfinden. Sie zu<br />
durchbrechen, wäre Aufgabe einer Studie, die die genannten Probleme<br />
inhaltlich, qualitativ analysiert. Als Vorarbeit hierfür ist<br />
Kreckers Untersuchung nützlich.<br />
Arno Bammé (Berlin/West)<br />
Schildkamp-Kündiger, Erika: Frauenrolle und Mathematikleistung:<br />
Pädagogischer Verlag Schwann. Düsseldorf<br />
1974 (120 S., br., 16,— DM).<br />
Am Beispiel 13- und 14jähriger Schülerinnen eines Gymnasiums<br />
wird die Leistung in Mathematik in Abhängigkeit einiger Persönlichkeits-<br />
und Umweltvariablen untersucht. Ausgangspunkt: Intelligenz<br />
ist notwendig, aber nicht hinreichend für das Erlernen der<br />
Schulmathematik; Selbstvertrauen fördert die Mathematikleistung,<br />
emotionelle Störungen hemmen sie, Mathematik ist nach verbreiteter<br />
Auffassimg Sache der Männer; Wertungen der Eltern beeinflussen die<br />
DAS ARGUMENT 92/1975 ©