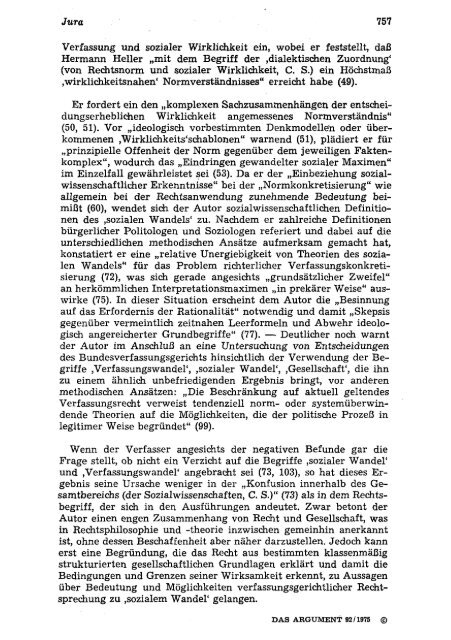Das Argument - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Das Argument - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Das Argument - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Jura 757<br />
Verfassung und sozialer Wirklichkeit ein, wobei er feststellt, daß<br />
Hermann Heller „mit dem Begriff der dialektischen Zuordnung'<br />
(von Rechtsnorm und sozialer Wirklichkeit, C. S.) ein Höchstmaß<br />
.wirklichkeitsnahen' Normverständnisses" erreicht habe (49).<br />
Er fordert ein den „komplexen Sachzusammenhängen der entscheidungserheblichen<br />
Wirklichkeit angemessenes Normverständnis"<br />
(50, 51). Vor „ideologisch vorbestimmten Denkmodelle'n oder überkommenen<br />
,Wirklichkeits'schablonen" warnend (51), plädiert er für<br />
„prinzipielle Offenheit der Norm gegenüber dem jeweiligen Faktenkomplex",<br />
wodurch das „Eindringen gewandelter sozialer Maximen"<br />
im Einzelfall gewährleistet sei (53). Da er der „Einbeziehung sozialwissenschaftlicher<br />
Erkenntnisse" bei der „Normkonkretisierung" wie<br />
allgemein bei der Rechtsanwendung zunehmende Bedeutung beimißt<br />
(60), wendet sich der Autor sozialwissenschaftlichen Definitionen<br />
des ,sozialen Wandels' zu. Nachdem er zahlreiche Definitionen<br />
bürgerlicher Politologen und Soziologen referiert und dabei auf die<br />
unterschiedlichen methodischen Ansätze aufmerksam gemacht hat,<br />
konstatiert er eine „relative Unergiebigkeit von <strong>Theorie</strong>n des sozialen<br />
Wandels" für das Problem richterlicher Verfassungskonkretisierung<br />
(72), was sich gerade angesichts „grundsätzlicher Zweifel"<br />
an herkömmlichen Interpretationsmaximen „in prekärer Weise" auswirke<br />
(75). In dieser Situation erscheint dem Autor die „Besinnung<br />
auf das Erfordernis der Rationalität" notwendig und damit „Skepsis<br />
gegenüber vermeintlich zeitnahen Leerformeln und Abwehr ideologisch<br />
angereicherter Grundbegriffe" (77). — Deutlicher noch warnt<br />
der Autor im Anschluß an eine Untersuchung von Entscheidungen<br />
des Bundesverfassungsgerichts hinsichtlich der Verwendung der Begriffe<br />
,Verfassungswandel', ,sozialer Wandel', Gesellschaft', die ihn<br />
zu einem ähnlich unbefriedigenden Ergebnis bringt, vor anderen<br />
methodischen Ansätzen: „Die Beschränkung auf aktuell geltendes<br />
Verfassungsrecht verweist tendenziell norm- oder systemüberwindende<br />
<strong>Theorie</strong>n auf die Möglichkeiten, die der politische Prozeß in<br />
legitimer Weise begründet" (99).<br />
Wenn der Verfasser angesichts der negativen Befunde gar die<br />
Frage stellt, ob nicht ein Verzicht auf die Begriffe ,sozialer Wandel'<br />
und ,Verfassungswandel' angebracht sei (73, 103), so hat dieses Ergebnis<br />
seine Ursache weniger in der „Konfusion innerhalb des Gesamtbereichs<br />
(der Sozialwissenschaften, C. S.)" (73) als in dem Rechtsbegriff,<br />
der sich in den Ausführungen andeutet. Zwar betont der<br />
Autor einen engen Zusammenhang von Recht und Gesellschaft, was<br />
in Rechtsphilosophie und -theorie inzwischen gemeinhin anerkannt<br />
ist, ohne dessen Beschaffenheit aber näher darzustellen. Jedoch kann<br />
erst eine Begründung, die das Recht aus bestimmten klassenmäßig<br />
strukturierten gesellschaftlichen Grundlagen erklärt und damit die<br />
Bedingungen und Grenzen seiner Wirksamkeit erkennt, zu Aussagen<br />
über Bedeutung und Möglichkeiten verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung<br />
zu .sozialem Wandel' gelangen.<br />
DAS ARGUMENT 92/1975 ©