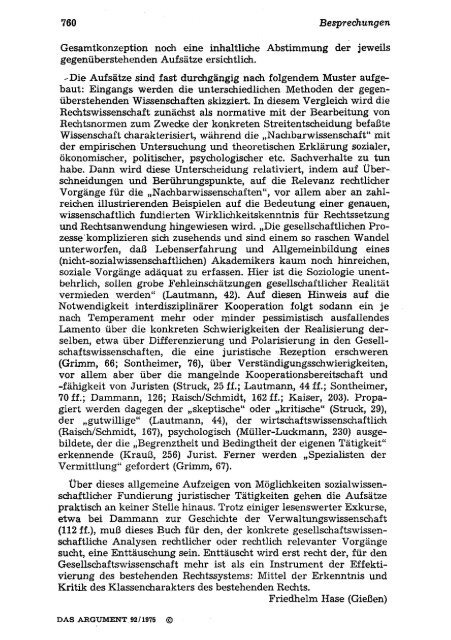Das Argument - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Das Argument - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Das Argument - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
760<br />
1 Besprechungen<br />
Gesamtkonzeption noch eine inhaltliche Abstimmung der jeweils<br />
gegenüberstehenden Aufsätze ersichtlich.<br />
-Die Aufsätze sind fast durchgängig nach folgendem Muster aufgebaut:<br />
Eingangs werden die unterschiedlichen Methoden der gegenüberstehenden<br />
Wissenschaften skizziert. In diesem Vergleich wird die<br />
Rechtswissenschaft zunächst als normative mit der Bearbeitung von<br />
Rechtsnormen zum Zwecke der konkreten Streitentscheidung befaßte<br />
Wissenschaft charakterisiert, während die „Nachbarwissenschaft" mit<br />
der empirischen Untersuchung und theoretischen Erklärung sozialer,<br />
ökonomischer, politischer, psychologischer etc. Sachverhalte zu tun<br />
habe. Dann wird diese Unterscheidung relativiert, indem auf Überschneidungen<br />
und Berührungspunkte, auf die Relevanz rechtlicher<br />
Vorgänge für die „Nachbarwissenschaften", vor allem aber an zahlreichen<br />
illustrierenden Beispielen auf die Bedeutung einer genauen,<br />
wissenschaftlich fundierten Wirklichkeitskenntnis für Rechtssetzung<br />
und Rechtsanwendung hingewiesen wird. „Die gesellschaftlichen Prozesse<br />
komplizieren sich zusehends und sind einem so raschen Wandel<br />
unterworfen, daß Lebenserfahrung und Allgemeinbildung eines<br />
(nicht-sozialwissenschaftlichen) Akademikers kaum noch hinreichen,<br />
soziale Vorgänge adäquat zu erfassen. Hier ist die Soziologie unentbehrlich,<br />
sollen grobe Fehleinschätzungen gesellschaftlicher Realität<br />
vermieden werden" (Lautmann, 42). Auf diesen Hinweis auf die<br />
Notwendigkeit interdisziplinärer Kooperation folgt sodann ein je<br />
nach Temperament mehr oder minder pessimistisch ausfallendes<br />
Lamento über die konkreten Schwierigkeiten der Realisierung derselben,<br />
etwa über Differenzierung und Polarisierung in den Gesellschaftswissenschaften,<br />
die eine juristische Rezeption erschweren<br />
(Grimm, 66; Sontheimer, 76), über Verständigungsschwierigkeiten,<br />
vor allem aber über die mangelnde Kooperationsbereitschaft und<br />
-fähigkeit von Juristen (Struck, 25 ff.; Lautmann, 44 ff.; Sontheimer,<br />
70 ff.; Dammann, 126; Raisch/Schmidt, 162 ff.; Kaiser, 203). Propagiert<br />
werden dagegen der „skeptische" oder „<strong>kritische</strong>" (Struck, 29),<br />
der „gutwillige" (Lautmann, 44), der wirtschaftswissenschaftlich<br />
(Raisch/Schmidt, 167), psychologisch (Müller-Luckmann, 230) ausgebildete,<br />
der die „Begrenztheit und Bedingtheit der eigenen Tätigkeit"<br />
erkennende (Krauß, 256) Jurist. Ferner werden „Spezialisten der<br />
Vermittlung" gefordert (Grimm, 67).<br />
Über dieses allgemeine Aufzeigen von Möglichkeiten sozialwissenschaftlicher<br />
Fundierung juristischer Tätigkeiten gehen die Aufsätze<br />
praktisch an keiner Stelle hinaus. Trotz einiger lesenswerter Exkurse,<br />
etwa bei Dammann zur Geschichte der Verwaltungswissenschaft<br />
(112 ff.), muß dieses Buch für den, der konkrete gesellschaftswissenschaftliche<br />
Analysen rechtlicher oder rechtlich relevanter Vorgänge<br />
sucht, eine Enttäuschung sein. Enttäuscht wird erst recht der, für den<br />
Gesellschaftswissenschaft mehr ist als ein Instrument der Effektivierung<br />
des bestehenden Rechtssystems: Mittel der Erkenntnis und<br />
Kritik des Klassencharakters des bestehenden Rechts.<br />
Friedhelm Hase (Gießen)<br />
DAS ARGUMENT 92/1975 ©