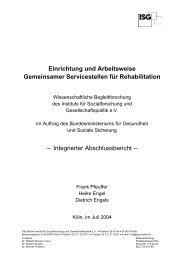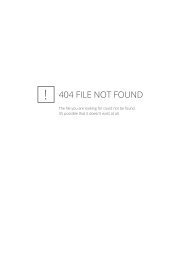Prio C Endbericht final.pdf - ISG
Prio C Endbericht final.pdf - ISG
Prio C Endbericht final.pdf - ISG
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kapitel 2: Ergebnisse und Wirkungen der <strong>Prio</strong>ritätsachse C<br />
<strong>ISG</strong><br />
richtete Nachholen von schulischen Bildungsinhalten über den Einsatz von Stützlehrer/innen wird<br />
entsprechend als wichtiger Bestandteil der Jugendwerkstätten gewertet. Diese Einschätzung wird<br />
durch ergänzende Analysen der Landesjugendämter Westfalen und Rheinland aus dem Jahr 2009<br />
gestützt.<br />
In Bezug auf das spezifische Ziel C2 „Verbesserung der beruflichen Integration von langzeitarbeitslosen<br />
Jugendlichen“ liegen ergänzende Informationen zu den Programmen 100 zusätzliche<br />
Ausbildungsplätze sowie Projekte für behinderte Menschen vor:<br />
<br />
<br />
Insgesamt erfolgt in zwei Berichten der G.I.B. eine positive Bewertung des als bedarfsgerecht<br />
eingeschätzten Förderangebots 100 zusätzliche Ausbildungsplätze, auch aufgrund des bislang<br />
realisierten Anteils an erfolgreichen Abschlüssen und Übergängen in Beschäftigung. An den<br />
bisher erreichten – quantitativen, aber auch qualitativen – Erfolgen haben die beteiligten Träger<br />
aufgrund ihrer Erfahrungen in der Rehabilitationsarbeit großen Anteil. Herausforderungen<br />
bei der weiteren Umsetzung sieht die G.I.B. hinsichtlich des „Klebeeffekts“ des Programms.<br />
Nach Einschätzungen der G.I.B. zeigen die bisherigen Erfahrungen außerdem, dass Betriebe<br />
unabhängig von ihrer Größe eher bereit sind, einen Jugendlichen mit Behinderung auszubilden,<br />
wenn sie in „geeigneter Weise“ über die zu erwartenden Beeinträchtigungen der Auszubildenden<br />
und über mögliche öffentliche Leistungen aufgeklärt werden, mit denen die behinderungsbedingten<br />
Auswirkungen kompensiert werden können.<br />
Zu den Projekten für behinderte Menschen liegt ebenfalls ein Bericht der G.I.B. vor, in dem der<br />
breite Förderansatz herausgestellt wird, mit dem unterschiedliche Zielgruppen angesprochen<br />
und passgenaue Förderkonstellationen umgesetzt werden können. Als Erfolg der Projekte<br />
wurde aufgrund der Heterogenität der Zielgruppen und Zielstellungen nicht zwangsläufig (nur)<br />
der Übergang der Teilnehmenden in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gewertet,<br />
sondern je nach Projekt auch der Übergang in Beschäftigung in den 2. Arbeitsmarkt sowie das<br />
Erreichen von Berufsabschlüssen oder Anschlussperspektiven in Ausbildung oder Qualifizierungsmaßnahmen.<br />
Die Auswertung der Projektbefragung zeigt Unterschiede in den Arbeitsweisen<br />
der Projektträger, aus denen die G.I.B. ein individualisiertes Vorgehen, ein hohes Maß<br />
Betriebsorientierung sowie die Intensität der Kooperation mit anderen Akteuren als zentrale Erfolgsfaktoren<br />
ableitet.<br />
Hinsichtlich des spezifischen Ziels C3 „Weiterentwicklung der zielgruppenorientierten Arbeitsmarktpolitik“<br />
liegen schließlich ergänzende Befunde zu den innovativen Vorhaben einerseits und<br />
den Erwerbslosenberatungsstellen/Arbeitslosenzentren andererseits vor:<br />
<br />
So zeigen Kurzbeschreibungen, die die G.I.B. in Bezug auf ausgewählte innovative Vorhaben<br />
veröffentlicht hat, dass mit diesem Förderangebot ein breites Spektrum an Fördermaßnahmen<br />
realisierbar ist. Die Projekte zeichnen sich durch modellhafte, innovative Ansätze aus, unterscheiden<br />
sich aber in der konkreten Ausgestaltung stark. Die Mehrzahl der Projekte zielt dabei<br />
auf die Integration der Teilnehmenden in Arbeitsverhältnisse auf dem ersten Arbeitsmarkt.<br />
Teilweise wird aber auch die Qualifizierung bzw. das „Fit-machen“ für den Arbeitsmarkt als<br />
Zielsetzung genannt. Heterogen sind auch die in den Projekten einbezogenen Zielgruppen.<br />
Angesprochen werden Migranten und Migrantinnen, Geringqualifizierte, Jugendliche, Berufsrückkehrer/innen,<br />
aber auch Familien bzw. größere Bedarfsgemeinschaften im SGB II sowie<br />
Strafgefangene. Einige Projekte zielen auch auf die Verbesserung der Netzwerkarbeit relevanter<br />
Arbeitsmarktakteure – z.B. zum Thema „Familienfreundlichkeit“ – in den Regionen. Die<br />
breite thematische Palette und die Unterschiedlichkeit der Projektansätze lässt insgesamt darauf<br />
schließen, dass es mit der Förderung innovativer Vorhaben im spezifischen Ziel C3 mög-<br />
- 120 -