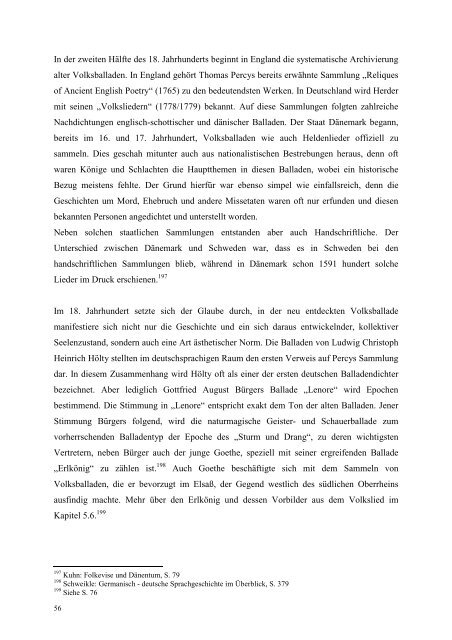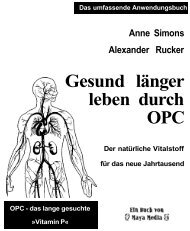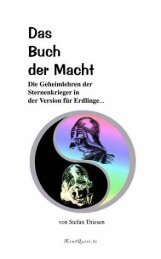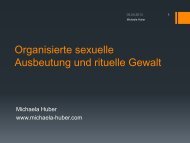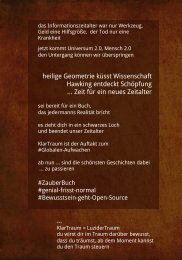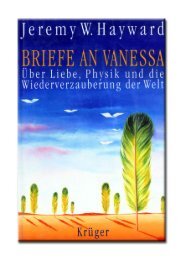Wiedergänger in der skandinavischen Literatur
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
In <strong>der</strong> zweiten Hälfte des 18. Jahrhun<strong>der</strong>ts beg<strong>in</strong>nt <strong>in</strong> England die systematische Archivierung<br />
alter Volksballaden. In England gehört Thomas Percys bereits erwähnte Sammlung „Reliques<br />
of Ancient English Poetry“ (1765) zu den bedeutendsten Werken. In Deutschland wird Her<strong>der</strong><br />
mit se<strong>in</strong>en „Volkslie<strong>der</strong>n“ (1778/1779) bekannt. Auf diese Sammlungen folgten zahlreiche<br />
Nachdichtungen englisch-schottischer und dänischer Balladen. Der Staat Dänemark begann,<br />
bereits im 16. und 17. Jahrhun<strong>der</strong>t, Volksballaden wie auch Heldenlie<strong>der</strong> offiziell zu<br />
sammeln. Dies geschah mitunter auch aus nationalistischen Bestrebungen heraus, denn oft<br />
waren Könige und Schlachten die Hauptthemen <strong>in</strong> diesen Balladen, wobei e<strong>in</strong> historische<br />
Bezug meistens fehlte. Der Grund hierfür war ebenso simpel wie e<strong>in</strong>fallsreich, denn die<br />
Geschichten um Mord, Ehebruch und an<strong>der</strong>e Missetaten waren oft nur erfunden und diesen<br />
bekannten Personen angedichtet und unterstellt worden.<br />
Neben solchen staatlichen Sammlungen entstanden aber auch Handschriftliche. Der<br />
Unterschied zwischen Dänemark und Schweden war, dass es <strong>in</strong> Schweden bei den<br />
handschriftlichen Sammlungen blieb, während <strong>in</strong> Dänemark schon 1591 hun<strong>der</strong>t solche<br />
Lie<strong>der</strong> im Druck erschienen. 197<br />
Im 18. Jahrhun<strong>der</strong>t setzte sich <strong>der</strong> Glaube durch, <strong>in</strong> <strong>der</strong> neu entdeckten Volksballade<br />
manifestiere sich nicht nur die Geschichte und e<strong>in</strong> sich daraus entwickeln<strong>der</strong>, kollektiver<br />
Seelenzustand, son<strong>der</strong>n auch e<strong>in</strong>e Art ästhetischer Norm. Die Balladen von Ludwig Christoph<br />
He<strong>in</strong>rich Hölty stellten im deutschsprachigen Raum den ersten Verweis auf Percys Sammlung<br />
dar. In diesem Zusammenhang wird Hölty oft als e<strong>in</strong>er <strong>der</strong> ersten deutschen Balladendichter<br />
bezeichnet. Aber lediglich Gottfried August Bürgers Ballade „Lenore“ wird Epochen<br />
bestimmend. Die Stimmung <strong>in</strong> „Lenore“ entspricht exakt dem Ton <strong>der</strong> alten Balladen. Jener<br />
Stimmung Bürgers folgend, wird die naturmagische Geister- und Schauerballade zum<br />
vorherrschenden Balladentyp <strong>der</strong> Epoche des „Sturm und Drang“, zu <strong>der</strong>en wichtigsten<br />
Vertretern, neben Bürger auch <strong>der</strong> junge Goethe, speziell mit se<strong>in</strong>er ergreifenden Ballade<br />
„Erlkönig“ zu zählen ist. 198 Auch Goethe beschäftigte sich mit dem Sammeln von<br />
Volksballaden, die er bevorzugt im Elsaß, <strong>der</strong> Gegend westlich des südlichen Oberrhe<strong>in</strong>s<br />
ausf<strong>in</strong>dig machte. Mehr über den Erlkönig und dessen Vorbil<strong>der</strong> aus dem Volkslied im<br />
Kapitel 5.6. 199<br />
197 Kuhn: Folkevise und Dänentum, S. 79<br />
198 Schweikle: Germanisch - deutsche Sprachgeschichte im Überblick, S. 379<br />
199 Siehe S. 76<br />
56