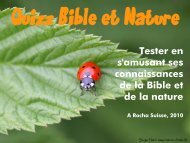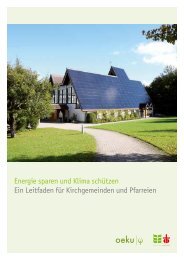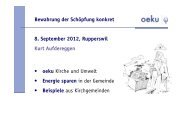Elektroheizungen in Kirchen - oeku Kirche und Umwelt
Elektroheizungen in Kirchen - oeku Kirche und Umwelt
Elektroheizungen in Kirchen - oeku Kirche und Umwelt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Begriffserklärungen<br />
Siehe auch RAVEL-Glossar «Gr<strong>und</strong>begriffe der Energiewirtschaft» [22].<br />
Klirna<br />
* Heizgrenze tgr<br />
Die Heizgrenze nennt man jene Tagesmitteltemperatur der Aussenluft, oberhalb welcher nicht mehr geheizt werden<br />
muss. Die Heizgrenze kann je nach Gebäudekonstruktion, Raumlufttemperatur <strong>und</strong> <strong>in</strong>ternem Wärmegew<strong>in</strong>n abweichen.<br />
Im Wohnbereich wird mit tgr = 12 °C gerechnet. Bei passiver Sonnenenergienutzung <strong>und</strong> bei Raumlufttemperaturen<br />
unter 20 °C ist die Heizgrenze entsprechend tiefer.<br />
* Heiztage HT<br />
Die Heiztage s<strong>in</strong>d diejenigen Tage e<strong>in</strong>er Periode, bei denen die Tagesmitteltemperatur (24-St<strong>und</strong>enMittelwert) der<br />
Aussenluft unter der Heizgrenze liegt.<br />
* Heizgradtage HGT<br />
Die Heizgradtage werden als Hilfsgrösse für die Berechnung des Energieverbrauchs von beheizten Gebäuden verwendet.<br />
Sie s<strong>in</strong>d die über e<strong>in</strong>e bestimmte Zeitperiode gebildete Summe der Temperaturdifferenzen zwischen Raumluft zur<br />
Aussenluft.<br />
k-Wert<br />
Fig. A33 Langjährige HGT-Mittelwerte aus SIAEmpfehlung 381/3<br />
[23] (Periode 1961 bis 1970)<br />
Es stehen von über 50 Stationen langjärige HGTWerte über<br />
e<strong>in</strong>zelne Monate, die Heizperiode oder das ganze Jahr zur<br />
Verfügung (siehe SIA-Empfehlung 381/3 «Heizgradtage der<br />
Schweiz», [23]).<br />
Die Heizgradtage werden für verschiedene Heizgrenzen (10, 12 <strong>und</strong><br />
14 °C) angegeben.<br />
Die Aussentemperatur (HGT) ist nicht die e<strong>in</strong>zige E<strong>in</strong>flussgrösse auf<br />
den Energieverbrauch von e<strong>in</strong>zelnen Gebäuden. Weitere wichtige<br />
Grössen s<strong>in</strong>d:<br />
- Die Strahlungsgew<strong>in</strong>ne (Sonne durch Fenster)<br />
- Die W<strong>in</strong>dverhältnisse<br />
-Interne Wärmequellen (Personen, Beleuchtung)<br />
- Das Benutzerverhalten (Lüftungsverhalten, effektive<br />
Raumtemperatur)<br />
Aktuelle HGT-Daten werden von der SMA <strong>in</strong> Fachzeitschriften<br />
publiziert.<br />
Energiekennzahl<br />
Def<strong>in</strong>ition <strong>und</strong> Erklärungen siehe Kapitel 6.1.<br />
Als k-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) wird der Wärmestrom bezeichnet, welcher durch 1 M2 e<strong>in</strong>es Bauteils fliesst,<br />
wenn der Temperaturunterschied der angrenzenden Luftschichten 1 Kelv<strong>in</strong> beträgt.<br />
Neben den Wärmeübertragungen Luft - Bauteil Luft, wird der k-Wert durch die Wärmeleitungseigenschaften (X, <strong>in</strong> W/mK)<br />
der Bau- <strong>und</strong> Wärmedämmstoffe bestimmt.<br />
Merke: Je kle<strong>in</strong>er der k-Wert, desto besser der Wärmeschutz:<br />
Die physikalische E<strong>in</strong>heit des k-Wertes ist Watt pro Quadratmeter <strong>und</strong> Kelv<strong>in</strong> [W/M2K]; 1 K entspricht 1 °C.<br />
Die E<strong>in</strong>heit kca l/M2h°C ist heute nicht mehr gebräuchlich (1 kcal/M2h°C = 1,163 W/M2K).<br />
Berechnung: siehe «k-Wert-Berechnung <strong>und</strong> Bauteilekatalog» [6]<br />
146