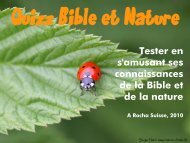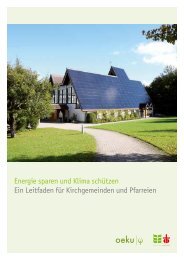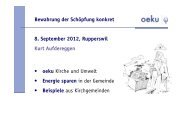Elektroheizungen in Kirchen - oeku Kirche und Umwelt
Elektroheizungen in Kirchen - oeku Kirche und Umwelt
Elektroheizungen in Kirchen - oeku Kirche und Umwelt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
3.2 Raumklirna <strong>und</strong> Orgel<br />
Gr<strong>und</strong>sätzliches<br />
Mozart schrieb <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Brief an se<strong>in</strong>en Vater: «Die Orgel ist doch <strong>in</strong> me<strong>in</strong>en Augen <strong>und</strong> Ohren der König aller<br />
Instrumente». Auch technisch gesehen wird die Orgel als «König<strong>in</strong> der Instrumente» bezeichnet. Sie ist auch das<br />
vielseitigste Instrument, das e<strong>in</strong> Spieler beherrschen kann.<br />
Es wäre unvollständig ja sogar fahrlässig, sich mit <strong><strong>Kirche</strong>n</strong>heizungen ause<strong>in</strong>anderzusetzen ohne speziell auf die Orgel -<br />
e<strong>in</strong>em der wichtigsten Ausstattungsgegenstände der <strong><strong>Kirche</strong>n</strong> <strong>und</strong> gleichzeitig auch klimatisch empf<strong>in</strong>dlichen Instrument<br />
- e<strong>in</strong>zugehen.<br />
Das vorliegende Kapitel hat drei Ziele.<br />
Erstens soll es e<strong>in</strong>e kurze Erklärung der Orgel se<strong>in</strong>. Dabei kann nur das Allerwichtigste erwähnt werden, welches für<br />
das Verständnis der Funktionsweise e<strong>in</strong>er Orgel <strong>und</strong> der Zusammenhänge mit dem Raumklima notwendig ist.<br />
E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> die Orgel<br />
Im folgenden werden nur die e<strong>in</strong>zelnen Bestandteile e<strong>in</strong>er Orgel <strong>und</strong> deren Funktion, nicht aber der Aufbau<br />
(Disposition), die klanglichen Eigenschaften <strong>und</strong> kulturgeschichtliche Belange beschrieben. Dabei stehen der<br />
Mechanismus <strong>und</strong> die verwendeten Materialien im Vordergr<strong>und</strong>.<br />
Pfeifen<br />
Es wird gr<strong>und</strong>sätzlich zwischen zwei Arten von Orgelpfeifen unterschieden:<br />
* Lippenpfeifen<br />
Als Zweites wird das Raumklima bezüglich der Erhaltung e<strong>in</strong>er Orgel diskutiert.<br />
Dieses Thema kann nicht abschliessend behandelt werden, da die Materie zu<br />
komplex <strong>und</strong> zu vielseitig ist. Es wird vielmehr versucht - wie bei der Bauphysik -<br />
aufzuzeigen, wann fachtechnische Beratung angezeigt ist.<br />
Der dritte Teil beschreibt die betrieblichen <strong>und</strong> musikalischen Anforderungen an<br />
das Raumklima aus der Sicht des Orgelspiels.<br />
Dieses Kapitel darf nur als Andeutung <strong>in</strong> die Orgelpraxis mit ihren vielen E<strong>in</strong>zeldiszipl<strong>in</strong>en verstanden werden.<br />
Als Literatur dienten die Bücher «Die Orgel» von Friedrich Jakob [13], «E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> den Orgelbau» von Wolfgang<br />
Adelung [14] <strong>und</strong> «Die akustischen Gr<strong>und</strong>lagen der Orgel» von Werner Lottermoser [15].<br />
Die meisten Pfeifen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Orgel, manchmal sogar alle, s<strong>in</strong>d Lippenpfeifen, deren Ton wie bei e<strong>in</strong>er Flöte durch die im<br />
Innern der Pfeife schw<strong>in</strong>gende Luftsäule erzeugt wird.<br />
Wird die Pfeife vom Fussloch her angeblasen, so strömt der W<strong>in</strong>d durch den Pfeifenfuss zur Kernspalte heraus, trifft auf<br />
die Oberlippe <strong>und</strong> gerät dort <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e wirbelnde, nach <strong>in</strong>nen <strong>und</strong> aussen wechselnde Pendelschw<strong>in</strong>gung. Dadurch wird<br />
die durch den darüberliegenden Pfeifenkörper umgrenzte Luftsäule <strong>in</strong> Vibration versetzt.<br />
Die Schnelligkeit dieser Schw<strong>in</strong>gung (Tonhöhe oder Frequenz genannt) hängt vorwiegend von der Länge der Luftsäule<br />
ab. E<strong>in</strong> Pfeifenkörper halber Länge erzeugt zum Beispiel die doppelte Schw<strong>in</strong>gungszahl <strong>und</strong> kl<strong>in</strong>gt deshalb e<strong>in</strong>e Oktave<br />
höher.<br />
Vere<strong>in</strong>facht dargestellt gelten folgende Abhängigkeiten:<br />
Pfeifenlänge => Tonhöhe<br />
Lippenbreite => Schall<strong>in</strong>tensität<br />
Durchmesser, Form, Material => Klangfarbe<br />
In Wirklichkeit s<strong>in</strong>d die Verhältnisse viel komplizierter, da sich nicht nur die e<strong>in</strong>zelnen Faktoren gegenseitig <strong>in</strong><br />
unterschiedlichem Masse bee<strong>in</strong>flussen,<br />
45