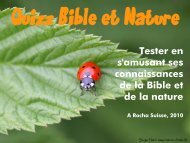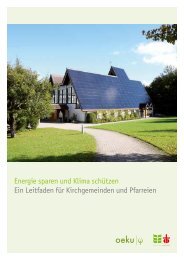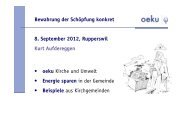Elektroheizungen in Kirchen - oeku Kirche und Umwelt
Elektroheizungen in Kirchen - oeku Kirche und Umwelt
Elektroheizungen in Kirchen - oeku Kirche und Umwelt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Raumklima <strong>und</strong> Betrieb der Orgel<br />
Es ist die kunstvolle Aufgabe des Organisten, die Orgel so zu bedienen d.h. den Orgelklang so durchzubilden, dass dadurch<br />
den Zuhörern <strong>und</strong> Zuhörer<strong>in</strong>nen der Aufbau <strong>und</strong> die Gestaltung jeder Orgelkomposition verständlich gemacht<br />
wird. Dies stellt hohe Anforderungen, weil der Klang e<strong>in</strong>er Orgel ausser der Bedienung über die Klaviatur von e<strong>in</strong>er<br />
Vielzahl von zusätzlichen E<strong>in</strong>flüssen abhängig ist. Dazu zählt beispielsweise auch das Raumklima.<br />
Verstimmung der Orgelpfeifen<br />
Bei Lippenpfeifen ist die Lufttemperatur <strong>in</strong> der Pfeife von besonderer<br />
Bedeutung, denn die Tonhöhe (Frequenz) ergibt sich aus dem<br />
Quotienten der Schallgeschw<strong>in</strong>digkeit durch die Wellenlänge. Die<br />
Wellenlänge wird durch die praktisch temperaturunabhängige<br />
Pfeifenlänge bestimmt.<br />
Die Schallgeschw<strong>in</strong>digkeit h<strong>in</strong>gegen hängt im besonderen Masse von<br />
der Temperatur ab:<br />
0 °C 331,8 m/s<br />
10 °C 337,8 m/s<br />
20 °C 343,8 m/s<br />
Deswegen ändert sich beispielsweise die Frequenz der Pfeife a1:<br />
Fig.59 Temperaturabhängigkeit der Pfeife a1 [15]<br />
Wenn bei e<strong>in</strong>er Temperatur von 15 °C der Kammerton al auf 440 Hz gestimmt wird, s<strong>in</strong>d folgende Frequenzen zu<br />
erwarten:<br />
10 °C 436,1 Hz<br />
12 °C 437,7 Hz<br />
14 °C 439,2 Hz<br />
15 °C 440,0 Hz<br />
16 °C 440,8 Hz<br />
18 °C 442,3 Hz<br />
20 °C 443,9 Hz<br />
Alle Lippenpfeifen e<strong>in</strong>er Orgel kl<strong>in</strong>gen also mit steigender Raumlufttemperatur höher als bei niedrigen Temperaturen.<br />
Zungenpfeifen reagieren im Vergleich zu den Lippenpfeifen nur ger<strong>in</strong>g auf Temperaturänderungen.<br />
Da der <strong><strong>Kirche</strong>n</strong>raum nur zu “Betriebszwecken” geheizt wird, stellt sich für den Organisten das Problem, an e<strong>in</strong>em meist<br />
verstimmten Instrument üben zu müssen. Das nicht “stubengemässe” Raumklima lädt zudem nicht gerade zum Oben<br />
e<strong>in</strong>.<br />
Stimmung der Orgel<br />
In der Fachliteratur werden für die Stimmung von Orgeln verschiedene Raumlufttemperaturen angegeben. Für <strong><strong>Kirche</strong>n</strong><br />
werden Temperaturen von 15 bis 18 °C, für Konzertsäle solche von bis zu 20 °C genannt.<br />
In der derzeitigen Tendenz, die Temperaturen für <strong><strong>Kirche</strong>n</strong>räume im Vergleich zu den 60iger Jahren während den<br />
Belegungen eher herabzusetzen, wäre für die Orgelstimmung angezeigt, den Kammerton al auf 15 °C festzulegen. Es<br />
ist anzunehmen, dass dieses psychologische Moment die Bestrebungen zahlreicher Fachleute, die Energie rationeller<br />
zu nutzen, mitunterstützt. Den Orgelbauern ist daher zu empfehlen, als Berechnungsgr<strong>und</strong>lage von 15 °C auszugehen.<br />
Es macht sicher ke<strong>in</strong>en S<strong>in</strong>n, die Orgel bei 18 °C zu stimmen, wenn die <strong>Kirche</strong> während den Betriebszeiten der Orgel<br />
auf 15 °C geheizt wird. Durch unterschiedliche Betriebstemperaturen wird die Stimmung der Orgel negativ bee<strong>in</strong>flusst.<br />
Es ist anzustreben die Raumlufttemperaturen im W<strong>in</strong>ter während dem Betrieb der Orgel nicht allzu stark schwanken zu<br />
lassen. E<strong>in</strong>e Begleitersche<strong>in</strong>ung zu den Temperaturschwankungen s<strong>in</strong>d Nachstimmungen der Orgel.<br />
Da die Zungenpfeifen <strong>in</strong> der M<strong>in</strong>derzahl s<strong>in</strong>d, werden sie jeweils nachgestimmt. Zungenpfeifen las,sen sich relativ<br />
e<strong>in</strong>fach durch Nachziehen der Stimmkrücke stimmen. Vorallem das Nachstimmen von Labialpfeifen ist wegen der<br />
Schläge auf die Pfeifenkörper möglichst seiten vorzunehmen. Schäden wie e<strong>in</strong>geschlagene Pfeifen, aufgerissene<br />
Stimmrollen oder Schäden an Stimmkrücke oder Nuss können die Folgen se<strong>in</strong>.<br />
Für jede Orgel sollte man sich fragen, wie oft <strong>und</strong> wann gestimmt werden soll. Dies richtet sich nach der Beheizung,<br />
dem speziellen Raumklima <strong>und</strong> der Orgel. So sollten Heizungsfachleute <strong>und</strong> Orgelbauer geme<strong>in</strong>sam darauf<br />
h<strong>in</strong>arbeiten, dass die Orgeln möglichst wenig gestimmt werden müssen.<br />
54