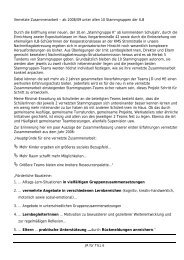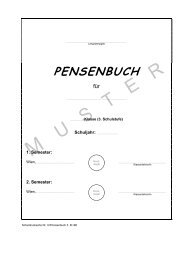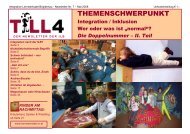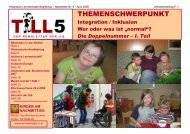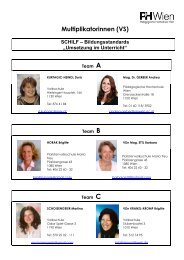Schulversuchsbroschüre 2010/11 - Referat für Schulversuche und ...
Schulversuchsbroschüre 2010/11 - Referat für Schulversuche und ...
Schulversuchsbroschüre 2010/11 - Referat für Schulversuche und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
46<br />
4.4 . Inklusive.Pädagogik<br />
Motiv:<br />
Im August 1997 wurde der Artikel 7 Abs. 1 B<strong>und</strong>esverfassungsgesetz (B-VG), BGBl. I Nr. 87/1997<br />
durch folgende Sätze ergänzt:<br />
„Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Die Republik (B<strong>und</strong>, Länder <strong>und</strong><br />
Gemeinden) bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung von behinderten <strong>und</strong> nicht behinderten<br />
Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewähr leisten.“ 1<br />
Des Weiteren befinden sich folgende relevante Textstellen in österreichischen Gesetz werken:<br />
» „Die öffentlichen Schulen sind allgemein ohne Unterschied der Geburt, des Geschlechts,<br />
der Rasse, des Standes, der Klasse, der Sprache <strong>und</strong> des Bekenntnisses zugänglich.“ 2<br />
» „Das Unterrichtsprinzip Interkulturelles Lernen soll „einen Beitrag zum besseren gegenseitigen<br />
Verständnis bzw. zur Wertschätzung, zum Erkennen von Gemeinsamkeiten <strong>und</strong><br />
zum Abbau von Vorurteilen leisten.“ 3<br />
» „Eine allenfalls vorhandene Zwei- oder Mehrsprachigkeit soll positiv besetzt <strong>und</strong> die SchülerInnen<br />
sollen ermuntert werden, Kenntnisse in der Muttersprache im Unterricht sinn voll<br />
einzubringen.“ 4<br />
Wenn sich eine Gesellschaft als demokratisch <strong>und</strong> human definiert, so muss sie von der Partizipation<br />
aller ihr innewohnenden Menschen an ihr ausgehen. Es muss das Be streben dieser Gesellschaft sein<br />
allen Faktoren, die die Ausgrenzung von Menschen zur Folge haben, auf allen Ebenen entgegen zu<br />
wirken – so auch im Bildungswesen.<br />
In der österreichischen Bildungslandschaft manifestierte sich dieser Gedanke in der Ein richtung<br />
von „Integrationsklassen“, in denen behinderte Kinder <strong>und</strong> nicht behinderte Kinder gemeinsam<br />
unterrichtet werden. Unter „Integration“ versteht man aber auch – gerade im Ballungsraum Wien –<br />
die Integration von SchülerInnen mit unter schiedlichen Herkunfts sprachen.<br />
Beide Modelle sind als Entwicklungsschritte zu einer nicht ausschließenden Ge sell schaft zu verstehen.<br />
Dennoch wird in beiden Fällen von einer Minderheit aus ge gangen, die der sogenannten Norm der<br />
Mehrheit nicht entspricht.<br />
Der Begriff „Inklusion“ stellt hingegen die Unterschiedlichkeit der Menschen als ge meinsames<br />
Merkmal des „Mensch-Seins“ in den Mittelpunkt der Betrachtung. Die Viel fältigkeit menschlichen<br />
Lebens in Bezug auf Geschlecht, Religion, Kultur, Sprache, soziale Lage <strong>und</strong> Fähigkeiten wird als<br />
„Entwicklungsressource“ <strong>für</strong> alle gesehen. „Heterogenität ist Normalität – mehr denn je!“ (HINZ<br />
2003)<br />
In der erziehungs- <strong>und</strong> bildungsrelevanten Praxis bedeutet dies, dass „alle Kinder <strong>und</strong> Schüler<br />
Innen in Kooperation miteinander auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau nach Maßgabe ihrer<br />
momentanen Wahrnehmungs-, Denk- <strong>und</strong> Handlungs kompe tenzen in Orientierung auf die `nächste<br />
Zone ihrer Entwicklung an <strong>und</strong> mit einem ge meinsamen Gegen stand spielen, lernen <strong>und</strong> arbeiten.“ 5<br />
Und dies soll <strong>für</strong> die Kinder <strong>und</strong> SchülerInnen in der Bildungseinrichtung geschehen, die in ihrem<br />
unmittelbaren Lebensumfeld liegt – sprich „Standort in Wohnnähe“.<br />
Zielsetzung:<br />
Im Wiener Bildungswesen gilt es Elemente einer „inklusiven“ Praxis zu erfassen <strong>und</strong> aus zubauen.<br />
Dazu bedarf es der Beschreibung von Kriterien, die pädagogisches Handeln als „inklusives“<br />
kennzeichnen. So soll es <strong>für</strong> PädagogInnen möglich sein ihre päda gogische Tätig keit als „inklusive“ zu<br />
erkennen. Leitidee ist der Heterogenität der Kinder <strong>und</strong> Schüler Innen durch „Innere Differenzierung<br />
durch Individualisierung“ <strong>und</strong> der Wahr nehmung der sozialen Dimension als Gruppe durch die<br />
„Kooperation am ge mein samen Gegenstand“ 6 ge recht zu werden.<br />
Kriterien einer „inklusiven“ Praxis<br />
» Ermöglichung der Kooperation durch den gemeinsamen Gegenstand (Lernen am<br />
g emeinsamen Thema, Lernnetze, kooperatives Lernen, Pro jekte, projekt orientierter<br />
1 BGBl. I Nr. 87/1997 zit.n. BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, GESUNDHEIT UND SOZIALES 1999, S.72<br />
2 §4 Abs. 1 SchOG<br />
3 BGBl. II Nr. 133/2000<br />
4 BGBl. II Nr. 134/2000<br />
5 FEUSER, Georg: Behinderte Kinder u. Jugendliche: Zwischen Integration u. Aussonderung. Darmstadt: Wiss. Buchges., 1995; S.173<br />
6 Unter „gemeinsamem Gegenstand“ ist hier nicht der Fachunterricht zu verstehen. Vielmehr lässt sich der Begriff als gemeinsame<br />
Aufgabe, Tätigkeit, als gemeinsames Projekt, Vorhaben, .... verstehen.