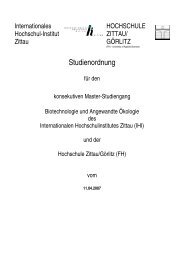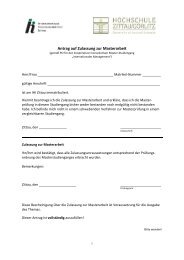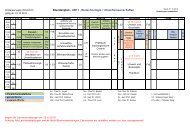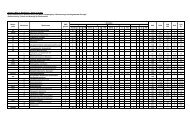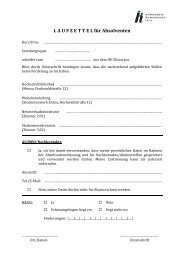1 Regionalentwicklung der Oberlausitz Chancen und ... - IHI Zittau
1 Regionalentwicklung der Oberlausitz Chancen und ... - IHI Zittau
1 Regionalentwicklung der Oberlausitz Chancen und ... - IHI Zittau
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Regionalentwicklung</strong> <strong>der</strong> <strong>Oberlausitz</strong> 129<br />
schaften in <strong>der</strong> vom Ansatz her mechanistischen Technikkultur <strong>der</strong> <strong>Oberlausitz</strong> auf wenig<br />
Verständnis treffen. 17 Wenn man jedoch mit dem Blick <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Soziologie, zum Beispiel<br />
mit Zygmunt Bauman 18 o<strong>der</strong> Gerhard Schulze 19 durch die <strong>Oberlausitz</strong> wan<strong>der</strong>t, wird<br />
man schnell feststellen, dass sich hier mittlerweile sehr unterschiedliche Lebens- <strong>und</strong> Deutungsgemeinschaften<br />
entwickelt haben, die teilweise überhaupt nichts miteinan<strong>der</strong> zu tun<br />
haben, forciert: zu tun haben wollen. Die sozialen Welten, o<strong>der</strong> präziser: die „sozialen <strong>Oberlausitz</strong>en“<br />
von Langzeitarbeitslosen, Pendlern, Studenten, Senioren, Migranten, Gewerbetreibenden<br />
o<strong>der</strong> den diversen Kameradschaften von Rechtsradikalen sind in ihrer Wirklichkeitsdeutung<br />
teilweise unterschiedlicher, wie sie nicht sein könnten. Der entscheidende<br />
soziologische Punkt ist dabei, dass diese Welten – Schulze nennt sie „Milieus“, man könnte<br />
hier auch von „Subkulturen“ sprechen – in keinem klar hierarchischen Verhältnis mehr zueinan<strong>der</strong><br />
stehen. Sie entwickeln sich vielmehr isoliert voneinan<strong>der</strong> als parallele, alternative<br />
Lebensentwürfe mit jeweils eigener interner Sozialstruktur <strong>und</strong> Wertegerüst nebeneinan<strong>der</strong><br />
her. Wer also „<strong>Regionalentwicklung</strong>“ sagt, muss wissen, dass es da um ganz verschiedene<br />
kollektive mentale Programmierungen geht, die sehr unterschiedliche, möglicherweise sogar<br />
inkommensurable Ausgangspunkte für die angestrebte Entwicklung darstellen. 20<br />
4. <strong>Regionalentwicklung</strong> als Problem <strong>der</strong> kulturellen Werteordnung<br />
4.1. Ein Orientierungsansatz für die <strong>Regionalentwicklung</strong><br />
Wenn sich ein Wissenschaftler nun mit diesen Megatrends befasst, um in konstruktiver<br />
Absicht positive Entwicklungschancen zu dechiffrieren, sollte er sich möglichst nicht mit<br />
einer Zusammenstellung von gegriffenen Einzelvorschlägen begnügen, son<strong>der</strong>n eine systematische<br />
Orientierung zu Gr<strong>und</strong>e legen, in die sich die verschiedenen Ideen einsortieren<br />
lassen. Man nutzt gewissermaßen die spezielle Perspektive („Brille“) einer Disziplin, um<br />
Entwicklungsvorschläge zu generieren <strong>und</strong> zu beurteilen. Häufi g wird dabei <strong>der</strong> nahe liegende<br />
Versuch gemacht, über eine ökonomisierende Betrachtung klar zu stellen, welche Trends<br />
etwas „Lohnendes“ beinhalten <strong>und</strong> dazu auffor<strong>der</strong>n, diese zu nutzen (Bsp.: „Rückzug des<br />
Staates = Chance für Unternehmertum“). An<strong>der</strong>e suchen nach Entwicklungstrends, die<br />
ihren politischen Interessen passgenau in die Karten spielen (Bsp.: „De-Industrialisierung<br />
= Globalisierungskritik“). Schließlich könnte man in einem „Land <strong>der</strong> Ingenieure“ auf den<br />
Gedanken kommen, das Lösungspotential <strong>der</strong> technischen Innovationen in den Vor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong><br />
zu stellen („Erfi n<strong>der</strong>geist = technologisch gestützte Existenzgründungen“).<br />
Erschöpft ist die Palette möglicher Perspektiven damit keineswegs, <strong>und</strong> es kann an dieser<br />
Stelle auch nicht <strong>der</strong> Frage nachgegangen werden, inwieweit sie im Sinne einer positiven<br />
Entwicklung erfolgversprechend o<strong>der</strong> eher problemverursachend sind, ob sie zu komplementären,<br />
synergetischen o<strong>der</strong> wi<strong>der</strong>sprüchlichen Ergebnissen führen, <strong>und</strong> inwieweit sie<br />
17 Es wäre schon viel damit gewonnen, wenn wenigstens die relevanten Stellen den kategorialen Unterschied zwischen<br />
dem Studium des Sozialwesens (Sozialarbeit, Heil- <strong>und</strong> Behin<strong>der</strong>tenpädagogik, etc.) <strong>und</strong> den Sozialwissenschaften (Soziologie,<br />
Politologie, Ökonomie) verstehen <strong>und</strong> berücksichtigen würden.<br />
18 Vgl. ZYGMUNT BAUMAN, Postmo<strong>der</strong>ne Ethik, Hamburg 1995; DERS., Flaneure, Spieler <strong>und</strong> Touristen, Hamburg 1997.<br />
19 Vgl. GERHARD SCHULZE, Die Erlebnis-Gesellschaft. Kultursoziologie <strong>der</strong> Gegenwart, Frankfurt/New York 1992.<br />
20 Zum Begriff <strong>der</strong> Inkommensurabilität <strong>und</strong> den Möglichkeiten ihrer Überwindung vgl. LUEKEN, Inkommensurabilität (wie<br />
Anm. 3); SCHERER, Pluralismus (wie Anm. 3).