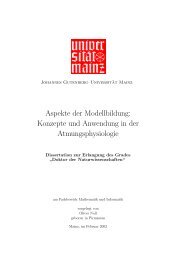verzeichnisse - ArchiMeD - Johannes Gutenberg-Universität Mainz
verzeichnisse - ArchiMeD - Johannes Gutenberg-Universität Mainz
verzeichnisse - ArchiMeD - Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
118<br />
6 Diskussion<br />
La/SS-B-Proteinmengen auf die Translationseffizienz der cDNA-Isoformen zurückzuführen<br />
waren. Durch eine densitometrische Bestimmung konnte gezeigt werden, dass alle in vitro<br />
transkribierten/translatierten alternativen cDNA-Isoformen mit gleicher Effizienz exprimiert<br />
wurden (Abb. 12). Im Gegensatz dazu konnte von GRÖLZ (1998) für die humanen<br />
La/SS-B-cDNA-Isoformen gezeigt werden, dass die Translationseffizienz der alternativen<br />
cDNA-Isoformen geringer war, als die der klassischen.<br />
Neben den murinen La/SS-B-Banden mit einem MW von etwa 45 kDa konnten auch<br />
einige schwächere Banden detektiert werden (Abb. 11). Diese Banden waren nur in den<br />
Laufspuren zu erkennen, in denen die Translationsprodukte der alternativen cDNA-Konstrukte<br />
des La/SS-B aufgetragen wurden. Somit konnten unspezifische Transkriptionen und<br />
Translationen von Anteilen des Vektors pcDNA3 ausgeschlossen werden. Auch konnten diese<br />
Banden keine Proteine aus dem Reticulozyten-Extrakt darstellen, da diese offensichtlich alle<br />
durch die Immundepletion mit dem für das La/SS-B-spezifische mAK 5B9 entfernt wurden.<br />
Demzufolge musste es sich bei diesen Banden ebenfalls um La/SS-B-Banden handeln. Bei den<br />
Banden mit ungefähr 43 und 28 kDa handelte es sich entweder um Degradationsprodukte des<br />
La/SS-B-Proteins, oder um ein N-terminal verkürztes La/SS-B-Protein, das durch interne<br />
Initiation entstanden sein musste (SCHÖRNER und DRATHEN, 2000; unveröffentlicht).<br />
In vitro-Translationssysteme mit Reticulozyten-Lysat neigten zur Artefaktbildung;<br />
mitunter kam es zur Entstehung von aberranten Translationprodukten. Diese<br />
Translationsprodukte entstanden vermutlich durch Initiation der Translation von einem intern<br />
gelegenen Methionin anstelle des korrekten Start-AUGs (SVITKIN et al., 1994). Die Banden mit<br />
einer Größe von etwa 43 und 28 kDa könnten solchen aberranten Translationsprodukten<br />
entsprechen. Die Banden mit einem MW von ca. 60 kDa könnten La/SS-B-Proteine darstellen,<br />
die mit verkürzten La/SS-B-Fragmenten assoziiert waren (BACHMANN, 2000; unveröffentlicht).<br />
Da die Nebenbanden jeweils gleich intensiv gefärbt waren, musste die<br />
in vitro-Translation und die Immundepletion bei allen Ansätzen mit einer vergleichbaren<br />
Effizienz abgelaufen sein. Darum war es auch zulässig, die Intensität der La/SS-B-Banden<br />
direkt miteinander zu vergleichen (Abb. 11).<br />
6.16 Der Translationsmechanismus der mRNAs<br />
Das scanning-Modell der Translation von eukaryontischen mRNAs (KOZAK, 1978)<br />
postulierte, dass die 40S-Ribosomenuntereinheit zusammen mit verschiedenen<br />
Translations-Initiationsfaktoren am 5’-Ende einer mRNA an die 7-Methylguanosinium-Kappe<br />
(m 7 Gppp-Kappe) band und über die 5´-UTR bis zu einem ersten Start-AUG mit einer für die<br />
Initiation der Translation vorteilhaften Umgebungssequenz (Kozak-Sequenz) (KOZAK, 1989;<br />
KOZAK, 1987) wanderte. Durch einen Vergleich von 699 Vertebraten-mRNAs wurde von<br />
KOZAK (1987) die Konsensussequenz GCCGCC A / G CCAUGG für die Initiation der Translation