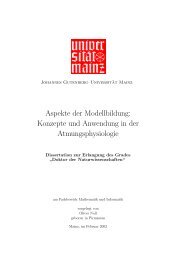verzeichnisse - ArchiMeD - Johannes Gutenberg-Universität Mainz
verzeichnisse - ArchiMeD - Johannes Gutenberg-Universität Mainz
verzeichnisse - ArchiMeD - Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
6 Diskussion 133<br />
1990b), Inhibition der Transkription (BACHMANN et al., 1989a; BACHMANN et al., 1987) und<br />
Apoptoseinduktion durch UV-Licht (BACHMANN et al., 1990b) (1.5.10).<br />
Ausgehend von der Überlegung, dass NO einen Stressfaktor für Zellen darstellen<br />
könnte, war es nicht weiter überraschend, dass Zellen, die mit dem NO-Donor GSNO inkubiert<br />
wurden, neben der üblichen nukleären Färbung teilweise eine zytoplasmatische Lokalisation<br />
oder sogar eine Translokation bis an die Zelloberfläche des La/SS-B-Proteins zeigten<br />
(Abb. 23). Dabei spielte die Dauer der Inkubationszeit kaum eine Rolle. Nach 2 h traten die<br />
ersten Protein-Translokationen auf. Trotz längerer Inkubationzeiten blieb das Verhältnis der<br />
Zellen, die nur eine Kernfärbung zeigten, zu denen konstant, die eine Translokation aufwiesen.<br />
Zusammengefasst zeigten die hier erhaltenen Ergebnisse, dass die murine<br />
La/SS-B-Expression von NO positiv beeinflusst werden konnte. Dies war für ein Haushaltsgen<br />
bei erster Betrachtung ungewöhnlich. Über den Grund einer Erhöhung der<br />
La/SS-B-Proteinkonzentration ließ sich nur spekulieren. NO bewirkte zum zweiten eine<br />
Translokation des La/SS-B-Proteins vom Zellkern in das Zytoplasma oder sogar auf die<br />
Zelloberfläche. Damit könnte NO eine pathogene Funktion zugeordnet werden, da somit eines<br />
der Zielautoantigene von Kollagenosen dem Immunsystem zugänglich gemacht wurde.<br />
6.21 Induktion von ANAs durch Immunisierung des humanen La/SS-B-Neoepitops<br />
6.21.1 epitope spreading induzierter ANAs<br />
Als Neoepitope wurden AS-Sequenzen oder –Strukturen bezeichnet, die unter normalen<br />
Umständen im Körper nicht gebildet wurden oder dem Immunsystem nicht zugänglich waren<br />
(1.3). Erst pathologische Veränderungen, z.B. somatische Mutationen, könnten zur Entstehung<br />
von Neoepitopen führen (1.3 und 1.5.9). Wenn diese im Laufe des Lebens entstanden, könnten<br />
Immunzellen dieses Epitop als fremd erkennen und dagegen vorgehen, da diese Immunzellen<br />
bei der Ausbildung der Selbsttoleranz nicht den Toleranzmechanismes unterworfen wurden.<br />
Falls Neoepitope zusätzlich Homolgien zu anderen körpereigenen Proteinen aufwiesen,<br />
könnten AK nach dem Mechanismus des molekularen mimikry gegen diese körpereigenen<br />
Proteine affin werden, d.h. es fand ein intermolekulares epitope spreading vom Neoepitop auf<br />
andere Proteine statt. Somit könnten Neoepitope dafür verantwortlich sein, dass die<br />
Selbsttoleranz des Immunsystems gegen Eigenantigene durchbrochen wurde und dadurch<br />
Autoimmunität entstand (LANZAVECCHIA, 1995). Die Neoepitope könnten des weiteren durch<br />
triggern des Immunsystems die Immunantwort aufrecht erhalten. Ebenso bestand die<br />
Möglichkeit, dass, wenn in körpereigenen Proteinen ein Neoepitop enthalten war, die gegen<br />
das Neoepitop gebildeten AK durch den Mechanismus des intramolekularen epitope spreading<br />
auf andere, native Epitope desselben Proteins reiften.<br />
Die Situation eines durch ein Neoepitop ausgelöstes intra- und intermolekulares epitope