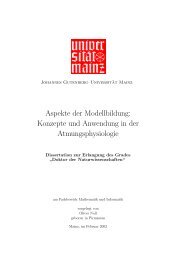verzeichnisse - ArchiMeD - Johannes Gutenberg-Universität Mainz
verzeichnisse - ArchiMeD - Johannes Gutenberg-Universität Mainz
verzeichnisse - ArchiMeD - Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
38<br />
4 Methoden<br />
4.13 Verdau von DNA mit Restriktionsendonukleasen<br />
COHEN et al. (1973) beschrieben zum ersten Mal die Möglichkeit, DNA unterschiedlicher<br />
Herkunft mittels Restriktionsendonukleasen zu schneiden und über kohäsive Enden miteinander zu<br />
ligieren. Auf diese Weise konnte Fremd-DNA in Plasmidvektoren eingebaut und in Bakterien vermehrt<br />
werden. Restriktionsenzyme von Bakterien erkannten kurze Folgen von palindromischen Nukleotiden und<br />
schnitten die DNA entweder direkt an (Typ II) oder versetzt (Typ I und Typ III) von ihrer<br />
Erkennungssequenz. Die zelleigene DNA der Prokaryonten wurde vor dem Abbau durch Modifikation der<br />
Erkennungssequenzen (Methylierung) geschützt (STRYER, 1991). Dieses Restriktionssystem diente dem<br />
Schutz vor Fremd-DNA, z.B. vor Bakteriophagen (KNIPPERS, 1997). Bei Reaktionsansätzen zum Verdau<br />
von Plasmid-DNA mit Restriktionsenzymen wurden 0,5-1,5 µg DNA in einem Gesamtvolumen von 30 µl<br />
bei 37°C für 3-4 h geschnitten. Die Enzyme wurden in einer Konzentration von 3-5 U/µg Plasmid-DNA<br />
eingesetzt. Bei allen Restriktionsverdauen nahm das Enzymvolumen nur maximal 10% des<br />
Gesamtvolumens ein, da das den Enzymen zugesetzte Glycerin die Enzymreaktion störte. Nach<br />
Beendigung der Inkubationszeit konnte die Reaktion bei den meisten Enzymen durch Hitzeinaktivierung<br />
bei 60-65°C für 20 min abgestoppt werden. Das sich während der Inkubation bei 37°C mit der Zeit am<br />
Deckel des Reaktionsgefäßes ansammelnde Kondenswasser wurde 2mal/h abzentrifugiert, um die<br />
Salzkonzentration konstant zu halten. Die im Labor verwendeten Restriktionsenzyme erzeugten glatte<br />
Enden oder schnitten die DNA an versetzten Stellen, so dass ein Überhang eines der beiden<br />
DNA-Stränge entstand. Auf diese Weise ließen sich durch den Verdau zweier verschiedener DNAs mit<br />
demselben Enzym kohäsive, d.h. zueinander passende Enden erzeugen. Dies wurde für Klonierungen<br />
genutzt, denn an diesen komplementären Stellen lagerten sich die DNA-Bruchstücke bevorzugt<br />
zusammen (COHEN et al., 1972).<br />
4.14 Ligation von DNA-Molekülen<br />
Zur Verknüpfung von Fremd-DNA und linearisiertem Plasmid wurde das Ligations Kit (3.5)<br />
verwendet. Die T4-DNA-Ligase (aus T4-Phage) bildete unter ATP-Verbrauch Phosphodiesterbindungen<br />
zwischen der freien 3'-OH-Gruppe des einen und der 5'-Phosphatgruppe des anderen Fragments<br />
(STRYER, 1991). Der Ligations-Reaktionsansatz umfasste ein Volumen von 10 µl und enthielt 50 ng<br />
linearisierte Vektor-DNA sowie Insert-DNA in einem molaren Verhältnis von 2:1 bis 10:1 (Insert-Enden :<br />
Vektor-Enden), 1 U T4-DNA-Ligase und 1 µl 10x Ligationspuffer. Die Inkubation erfolgte für 24-48 h bei<br />
4°C, obwohl das Temperaturoptimum der Ligase bei 37°C lag. Jedoch waren bei dieser Temperatur die<br />
Wasserstoffbrückenbindungen der gepaarten DNA-Enden instabil. Die einzusetzende Insert-DNA-Menge<br />
ließ sich nach folgender Formel berechnen (SAMBROOK et al., 1989):<br />
Vektor-DNA [ng] x Größe d. Insert-DNA [kb]<br />
Insert-DNA [ng] = x gew. Verh. Insert-Enden<br />
Größe des Vektors [kb]<br />
Vektor-Enden<br />
wobei das gewünschte Verhältnis (gew. Verh.) von der Art der Klonierung abhing. Bei einer gerichteten<br />
Klonierung (4.14.1) wurde ein Verhältnis von 2:1, bei einer T/A-Klonierung (4.14.2) ein Verhältnis von bis<br />
zu 10:1 (Insert-Enden : Vektor-Enden) gewählt.