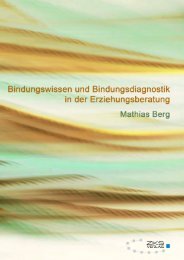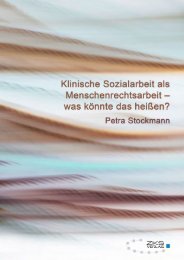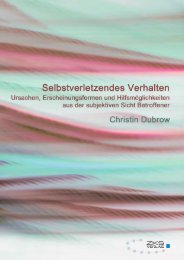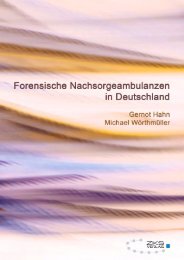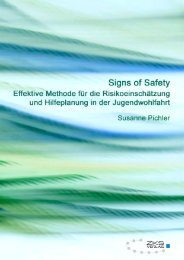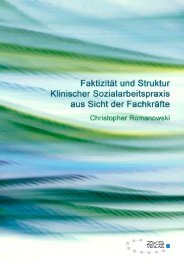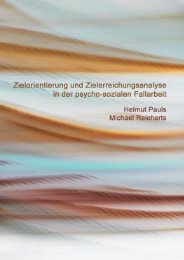3 Praktische Fundierung ambulanter Soziotherapie am ... - ZKS-Verlag
3 Praktische Fundierung ambulanter Soziotherapie am ... - ZKS-Verlag
3 Praktische Fundierung ambulanter Soziotherapie am ... - ZKS-Verlag
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Aufenthalten im Jahr lediglich einen verzeichnen (vgl. Z. 664f.). Somit ist die Reduzierung<br />
der Anzahl von Klinikaufenthalten als Fortschritt zu begreifen (vgl. Melchinger/Kunze 1997:<br />
146) und durch Maßnahmen in der Lebenswelt der Klienten zu erreichen.<br />
Ein weiterführendes Potential sieht Hoffmann in dem Gebrauch effektiver Methoden der<br />
Sozialen Arbeit, speziell auch der Klinischen Sozialarbeit. Somit muss nichts neu<br />
erfunden, sondern vielmehr integriert und angepasst werden. Sie persönlich wendet, wie<br />
bereits in Punkt 3.2.3 illustriert, vornehmlich die klientenzentrierte Gesprächsführung<br />
sowie das Engaging an (ab Z. 278ff.). Hoffmann kann aus eigener Erfahrung heraus beur-<br />
teilen, dass es für die psychisch Erkrankten von großer Bedeutung ist, wertgeschätzt und<br />
verstanden zu werden sowie die Fähigkeit entwickeln zu können, eigene Wünsche zu<br />
äußern. Themenorientiertes Arbeiten auf der Grundlage von festgelegten Zielen ist der<br />
Soziotherapeutin daneben ebenso wichtig und in der AS gut zu vereinen (vgl. Z. 281-285).<br />
„Und das Schöne ist ja an der <strong>Soziotherapie</strong>, dass man diese Ziele eben nicht alleine fest-<br />
legt, sondern wirklich zus<strong>am</strong>men mit dem Patienten und dem Arzt“ (Z. 340f.).<br />
Eine förderliche Zus<strong>am</strong>menarbeit ist daraus resultierend eine der Hauptvoraus-<br />
setzungen, um die AS bestmöglich umsetzen zu können. Diese Zus<strong>am</strong>menarbeit wird u.a.<br />
durch feststehende Regelungen gesichert, wie z.B. durch Vorgaben zur Dokumentations-<br />
führung sowie zur Betreuungsplanung (vgl. Z. 342f.) und funktioniert in Jena beispielhaft.<br />
Neben dem Vorteil bestimmter Festlegungen sieht Hoffmann diverse Nützlichkeiten in<br />
der Spaltung von Leistungsinhalten in „Muss"- und „Kann-Leistungen" (s. S. 81-83). Unter<br />
Pflichtleistungen versteht sie die Koordination der einzelnen ärztlich verordneten Maß-<br />
nahmen im Sinne des CM. In diesen sieht sie das Potential, dass diverse<br />
Angebote miteinander kombiniert, hinzugefügt oder bedarfsweise beendet werden können.<br />
Sie kann in der Hinsicht in Zus<strong>am</strong>menarbeit mit den Klienten entscheiden, was in der je-<br />
weiligen Situation folgerichtig ist oder nicht. Die Koordination der Helfer zähle zu einem<br />
weiteren wichtigen Element (vgl. Z. 353-378) und macht Absprachen unentbehrlich.<br />
Des Weiteren zeige sich die Durchführung soziotherapeutischer Maßnahmen, im Sin-<br />
ne der „Kann-Leistungen”, als erforderlicher Indikator für das Erreichen festgelegter Ziele.<br />
Dabei gehe es laut Hoffmann primär um die begleitende Unterstützung der Betroffenen,<br />
unabhängig von expliziten GKV-Leistungen. Übungen im Bereich der sozialen Kontaktfä-<br />
higkeit, Kommunikationstrainings oder das Training von Selbst- und Fremdwahrnehmung<br />
zählen dabei zu potentiellen Maßnahmen, um z.B. Krisenwarnzeichen zu vermitteln und<br />
zudem die Aufmerks<strong>am</strong>keit der Klienten in Bezug auf ihre Krankheitssymptome zu fördern<br />
(vgl. Z. 379-397). Hierbei wird die Bedeutung der sozialen Komponente wiederum deutlich.<br />
Nicht alle Angebote im psychiatrisch-<strong>am</strong>bulanten Bereich setzen sich mit derart grundle-<br />
genden und gleichwohl wichtigen Elementen des menschlichen Lebens auseinander.<br />
48