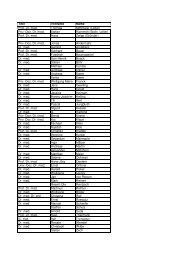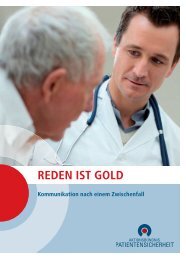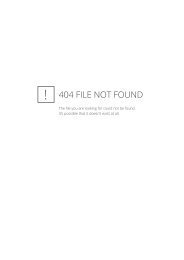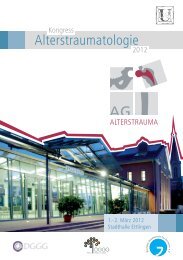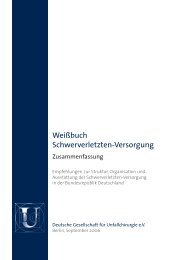Das Buch als PDF - Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie
Das Buch als PDF - Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie
Das Buch als PDF - Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
256 257VON DER SPONGIOSAPLASTIK ZUM GENTRANSFERKnochenersatzmaterialien Calziumphosphate, -keramiken, -zementeZur Vermeidung der immunologischen und infektiösen Probleme von allogenembzw. xenogenem Material und aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeitvon autogenem Knochen wurden schon 1920 von Albee (1876 – 1945)Versuche mit synthetischem Knochenersatzmaterial durchgeführt. Aber erstAnfang der 70er Jahre erfolgt die klinische Anwendung von synthetischenCalciumphosphaten, zunächst vornehmlich in Form von Hydroxylapatit.Calciumphosphate bestehen aus Calciumoxid und aus Diphosphorpentoxidin unterschiedlichen stöchiometrischen Verhältnissen. Zum einenfinden diese Calciumphosphate Anwendung <strong>als</strong> sogenannte Knochenzemente.Hierbei wird nach Verbindung mit einer Starterlösung das meistpulverförmige Ausgangsmaterial des Knochenzementes <strong>als</strong> Paste in denDefekt eingebracht und härtet vor Ort aus.Knochenzemente besitzen aufgrund ihrer fehlenden Makroporosität keineosteokonduktiven Eigenschaften und können somit nur vom Randbereichaus auf zellulärer Ebene abgebaut werden. Hierdurch kommt es zu einersehr langsamen Resorption. Ein weiterer Nachteil der fehlenden Porosität istdie ausbleibende Osteointegration, d.h. die vollständige Durchbauung desImplantates durch reparierenden autogenen Knochen. Um eine erwünschteMakroporosität zu erhalten, muss das pulverförmige Ca-/P-Ausgangsmaterialdurch Druck und Hitze (in Anwesenheit eines Makroporenbildners)gesintert werden. Durch diese Sinterungsprozesse entstehen Calciumphosphatkeramikenin unterschiedlicher Porosität und mit differenten stöchiometrischenCalcium-Phosphat-Verhältnissen. Dieses Ca-/P-Verhältnis ist(mit-)entscheidend für das spätere Verhalten nach der orthotopen Implantationin den Knochen. Hydroxylapatit (HA, Ca5(PO4)3OH) mit einem stöchiometrischenVerhältnis von Calcium zu Phosphat von 1:1,67 hat eine hohechemische (im biologichen Milieu) und mechanische Stabilität; aufgrundseiner geringen Wasserlöslichkeit kann dieses daher nur über zelluläre Prozesseabgebaut werden. Dieses geschieht sehr langsam, in Abhängigkeit vonder Größe des Implantates kann dies Jahre bis Jahrzehnte dauern. Andersverhält es sich bei ß-Tricalciumphosphat (ß-TCP, ß-Ca3(PO4)2) mit einemstöchiometrischen Verhältnis von Calcium zu Phosphat von 1:1,5. Dieseszeigt weder die hohe chemische noch mechanische Stabilität, kann aber aufgrundseiner guten Wasserlöslichkeit deutlich besser resorbiert werden. Beiallen Calciumphosphatkeramiken kommt es – auch in Abhängigkeit von dervorhandenen Makroporengröße und deren Interkonnektion, <strong>als</strong>o aufgrundihrer Fähigkeiten osteokonduktiv zu sein – zu einer guten Integration in denumgebenden Knochen. Somit erfüllen diese Keramiken eine der drei obengenannten Anforderungen an ein gutes Knochenimplantat.Bone Morphogenetic Protein und WachstumsfaktorenDen osteoinduktiven Anspruch an ein Knochenersatzmaterial erfüllen dieBone morphogenic proteins (BMPs), hier insbesondere das BMP-2 und-7. Diese zur transforming growth factor (TGF) ß Superfamilie gehörendenProteine können die sogenannte osteoinduktive Kaskade anstossen. Diesbedeutet, dass nach ihrer Implantation zum Beispiel in die Muskulatur vonRatten de novo Knochen entsteht. Spezifisch sind sie in der Lage, im Osteoblastendie Produktion von alkalischer Phosphatase zu induzieren.Der Grundstein für die Charakterisierung von Proteinen, welche das Knochenwachstumstimulieren, wurde bereits 1965 von Marshall Urist gelegt.Dieser erkannte, dass das Einbringen von demineralisiertem Knochen in Muskulatureine Bildung von Knorpel und Knochen zur Folge hat. Auf der Basisdieser Entdeckung formulierte er, dass es eine Substanz geben müsse, dienach einer heterotopen Implantation die Knochenbildung de novo induzierenwürde. Urist ging davon aus, dass diese Substanz ein Protein sei undbezeichnete sie <strong>als</strong> „bone morphogenetic protein“. Durch aufwendigeExtraktionsverfahren gelang es Urist schließlich 1984, das erste BMP aufzureinigenund die Proteinsequenz zu entschlüsseln. Weitere 4 Jahrespäter konnten 1988 Wozney und Rosen den genetischen Code von BMP1-3 entschlüsseln. Schließlich wurde 1990 durch Wang et al. humanesBMP-2 erstmalig rekombinant hergestellt und mit diesem rhBMP-2 eineektope Knochenbildung im Tierexperiment ausgelöst. Nach einer Fülleweiterer tierexperimenteller und später klinischer Studien, die unter